Landesgeschichte
https://digireg.twoday.net/stories/5269178/
Siehe zu Ortschroniken in Archivalia:
https://archiv.twoday.net/search?q=ortschron
Siehe zu Ortschroniken in Archivalia:
https://archiv.twoday.net/search?q=ortschron
KlausGraf - am Dienstag, 21. Oktober 2008, 18:50 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 7. Oktober 2008, 19:27 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://books.google.de/books?id=Fx8TAAAAYAAJ&pg=PA179
Autor des Buchs ist der badische Rat Johann Jakob Reinhard (Google fälschlich: Martin Gerbert). Das autographe Konzept der "Pragmatischen Geschichte" liegt im GLAK 74/558.
Zum Kontext siehe
https://archiv.twoday.net/stories/104752/
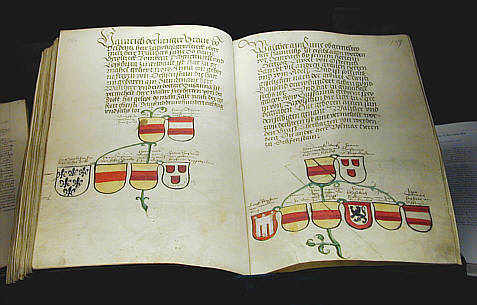
Quelle: https://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/territor/geroldseck/pappenheim.htm
Autor des Buchs ist der badische Rat Johann Jakob Reinhard (Google fälschlich: Martin Gerbert). Das autographe Konzept der "Pragmatischen Geschichte" liegt im GLAK 74/558.
Zum Kontext siehe
https://archiv.twoday.net/stories/104752/
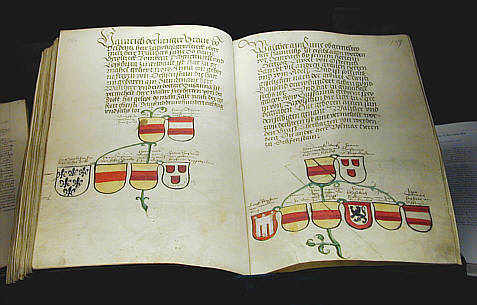
Quelle: https://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/territor/geroldseck/pappenheim.htm
KlausGraf - am Freitag, 3. Oktober 2008, 15:42 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
URL: https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5841/
Graf, Klaus
Der Ring der Herzogin: Überlegungen zur "Historischen Sage" am Beispiel der Schwäbisch Gmünder Ringsage, in: Babenberger und Staufer (Schriften zur staufischen Geschichte und Kunst; 9), Göppingen 1987, S. 84-134
Mein 30. Freidok-Upload!
pdf-Format:
Dokument 1.pdf (28.991 KB)
Behandelt wird die seit dem Ende des 16. Jahrhunderts in schriftlichen Quellen greifbare Ringsage der Stadt Schwäbisch Gmünd, die Ursprungsüberlieferung der St. Johanniskirche, derzufolge die Kirche einem Gelübde zufolge an der Stelle erbaut worden sein soll, an der Herzogin Agnes, Gemahlin des ersten Stauferherzogs Friedrich I., ihren Ehering wiedergefunden habe. Eine Parallele besitzt diese Staufer-Tradition in der Klosterneuburger Schleierlegende, in der es um den Verlust des Brautschleiers der gleichen Agnes geht. Herausgearbeitet werden die unterschiedlichen Bedeutungen der Überlieferung. Thematisiert werden auch methodische Grundfragen bei der Erforschung sogenannter "historischer Sagen". Gliederung: 1. Die vier ältesten Fassungen; 2. Gelehrte Erörterung; 3. Die Johanniskirche als Erzähl-Mal; 4. Das Wunderbare; 5. Staufer-Überlieferung: Agnes und Friedrich; 6. Staufer-Romantik im 19. Jahrhundert; 7. Zur Frage nach der »ursprünglichen Fassung«; 8. Zur Frage nach dem »historischen Kern«; 9. Die Erbauung der Johanniskirche: Offene Fragen; 10. Zur Kritik des Begriffs »Historische Sage«; 11. Träger und Funktion; 12. Herkommen und Exemplum, Ätiologie und Beglaubigung; 13. Für eine interdisziplinäre Erzählforschung.
PDF mit leicht korrigierter OCR. Die Darstellung knüpft an einen Aufsatz von 1982 an: Die Gmünder Ringsage. Entstehung und Entwicklung einer Staufer-Überlieferung, in: einhorn-Jahrbuch 1982, S. 129-150. Nachträgliche Quellenfunde zur Ringsage im 19. Jahrhundert finden sich in dem Aufsatz: Das Salvatorbrünnlein (1995): https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5585/. Die methodischen Überlegungen fanden Eingang in den Beitrag: Thesen zur Verabschiedung des Begriffs der 'historischen Sage' (1988), http:/www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5273/ .
Zu weiteren Sagen-Aufsätzen von mir:
https://archiv.twoday.net/stories/4990762/
Zwei Versionen der Gmünder Ringsage auf Wikisource:
https://de.wikisource.org/wiki/Zwei_Versionen_der_Gmünder_Ringsage
Weitere:
https://de.wikisource.org/wiki/Schwäbisch_Gmünd#Ringsage
 Darstellung der Ringsage 1714
Darstellung der Ringsage 1714
Graf, Klaus
Der Ring der Herzogin: Überlegungen zur "Historischen Sage" am Beispiel der Schwäbisch Gmünder Ringsage, in: Babenberger und Staufer (Schriften zur staufischen Geschichte und Kunst; 9), Göppingen 1987, S. 84-134
Mein 30. Freidok-Upload!
pdf-Format:
Dokument 1.pdf (28.991 KB)
Behandelt wird die seit dem Ende des 16. Jahrhunderts in schriftlichen Quellen greifbare Ringsage der Stadt Schwäbisch Gmünd, die Ursprungsüberlieferung der St. Johanniskirche, derzufolge die Kirche einem Gelübde zufolge an der Stelle erbaut worden sein soll, an der Herzogin Agnes, Gemahlin des ersten Stauferherzogs Friedrich I., ihren Ehering wiedergefunden habe. Eine Parallele besitzt diese Staufer-Tradition in der Klosterneuburger Schleierlegende, in der es um den Verlust des Brautschleiers der gleichen Agnes geht. Herausgearbeitet werden die unterschiedlichen Bedeutungen der Überlieferung. Thematisiert werden auch methodische Grundfragen bei der Erforschung sogenannter "historischer Sagen". Gliederung: 1. Die vier ältesten Fassungen; 2. Gelehrte Erörterung; 3. Die Johanniskirche als Erzähl-Mal; 4. Das Wunderbare; 5. Staufer-Überlieferung: Agnes und Friedrich; 6. Staufer-Romantik im 19. Jahrhundert; 7. Zur Frage nach der »ursprünglichen Fassung«; 8. Zur Frage nach dem »historischen Kern«; 9. Die Erbauung der Johanniskirche: Offene Fragen; 10. Zur Kritik des Begriffs »Historische Sage«; 11. Träger und Funktion; 12. Herkommen und Exemplum, Ätiologie und Beglaubigung; 13. Für eine interdisziplinäre Erzählforschung.
PDF mit leicht korrigierter OCR. Die Darstellung knüpft an einen Aufsatz von 1982 an: Die Gmünder Ringsage. Entstehung und Entwicklung einer Staufer-Überlieferung, in: einhorn-Jahrbuch 1982, S. 129-150. Nachträgliche Quellenfunde zur Ringsage im 19. Jahrhundert finden sich in dem Aufsatz: Das Salvatorbrünnlein (1995): https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5585/. Die methodischen Überlegungen fanden Eingang in den Beitrag: Thesen zur Verabschiedung des Begriffs der 'historischen Sage' (1988), http:/www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5273/ .
Zu weiteren Sagen-Aufsätzen von mir:
https://archiv.twoday.net/stories/4990762/
Zwei Versionen der Gmünder Ringsage auf Wikisource:
https://de.wikisource.org/wiki/Zwei_Versionen_der_Gmünder_Ringsage
Weitere:
https://de.wikisource.org/wiki/Schwäbisch_Gmünd#Ringsage
 Darstellung der Ringsage 1714
Darstellung der Ringsage 1714KlausGraf - am Freitag, 3. Oktober 2008, 01:25 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Peter Brommer, Kurtrier am Ende des Alten Reichs. Edition und Kommentierung der kurtrierischen Amtsbeschreibungen von (1772) 1783 bis ca. 1790 (= Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte Bd. 124/1-2), Mainz: Selbstverlag der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte 2008. 1472 S.
Inhaltsverzeichnis als PDF
Nach der positiven Resonanz auf seine Edition des kurtrierischen Feuerbuchs von 1563 (2003) hat sich der Koblenzer Archivar Peter Brommer entschlossen, auch die im Landeshauptarchiv Koblenz vorhandenen kurtrierischen Amtsbeschreibungen herauszugeben. In einem Generalrundschreiben forderte der Erzbischof 1783 die Ämter auf, ausführliche Beschreibungen mit Angaben über Grenzen, innere Verfassung, Gerichtsbarkeiten, fremde Enklaven und Verträge mit Auswärtigen einzureichen, ein Auftrag, den die Ämter äußerst saumselig erfüllten. Als letztes sandte 1792 das Amt Camberg den Bericht ein. Diese Berichte stellen eine großartige landeskundliche Quelle dar, die nunmehr bequem benutzbar ist. Brommer kommentiert die Berichte ausführlich, wobei er für jeden Ort demographische Angaben aus den Archivalien erhoben hat. Das ehemalige Territorium Kurtrier hat somit ein neues Standardwerk erhalten, auf dessen Heranziehung niemand wird verzichten können, der sich forschend mit orts- und landesgeschichtlichen Fragen im Gebiet des nördlichen heutigen Bundeslandes Rheinland-Pfalz befasst.
90 Euro für die beiden Bände ist zwar nicht überteuert, aber für etliche Heimatforscher einfach nicht erschwinglich.
Neben ihrem eher nüchternen statistisch-juristischen Hauptinhalt enthalten die Berichte ab und zu auch spannende Details. Hierzu einige Beispiele:
S. 31 Archäologische Funde in Güls
S. 125 Der "Stumpfe Turm" bei Baldenau wird als "überbleibsel uralter heidnischer architecturen" angesehen. Eine Heidenstadt genannt Sommerburg soll zur Zeit der Hunnen geschleift worden sein.
S. 189 Traditionen zur Kleeburg im Oberamt Boppard.
S. 474 Als Beispiel für die Angaben zur Charaktersistik der Einwohner sei zitiert: "Der Mayener ist gesund und starken leibes, leichtgläubig, eigennützig, hängt den mantel nach dem winde, ist zu aller arbeit geschickt, aber nicht emsig, ist nicht häuslich, vielmehr dem weine sehr ergeben und sehr hitzig".
S. 683 "Der zu Dahlen, pfarr Meud, befindliche einzige protestant in hiesigem amt nahmens Cristian Meyer, von Maxein in dem Hachenburgischen gebürtig, hat sich vor 23 jahren nach Dahlen verheurathet, lasset seine kinder alle katholisch erziehen, haltet dieselbe zum schuhl- und kirchengang strenger an als einer der übrigen pfarrgenossenen, gehet selbst fleisig in die pfarrkirche, ja auch in jene andachten, wo blos das hochwürdige gut verwahret wird, singet und bethet alles ohne ausnahm mit seinen nachbaren, bleibt gleichwohlen immer protestant und haltet alljährlich 1 oder höchstens 2 mal das nachtmahl mit den reformirten zu Maxein". (Eine Gestalt wie aus Hebels Kalendergeschichten, finde ich.)
S. 701 Eine wiederkehrende Neckerei des oberen gegen das untere Kirchspiel Salz (Amt Montabaur) führte immer wieder dazu, dass "sich ortschaft gegen ortschaft, jung und alt in der haaren lagen".
S. 883 Oberamt Münstermaifeld: "Ausser dießen finde in der gerichtsrepositur nichst weithers und sonder bedeutendes ausser der vormahlig hieselbst ausgeübten criminaljurisdiction vermittels im vorigen seculo in jahren 1620 bis 1640 instituirten theils accusations-, theils inquisitionesprocess gegen vorgebliche hechsen und zauberer, so in superstitionen und pactis bestandten haben solle. Die damahlige procedur gefallet mir aber nicht und erachte besser zu sein, daß diese acta verbrennet, alß zum ferneren vorschein kommen sollten."
S. 885f. Überlieferungen zur Maifelder Genoveva und zur Belagerung der Burg Turant.
S. 1121 "Pfahlgraben" (römischer Limes) im Amt Wehrheim.
Mängel weisen die Register auf (erfreulicherweise ist auch ein sehr ausführlicher Sachindex beigegeben). Unter Genovefa, Heilige wird nur die S. 480 ausgeworfen. Niemand kommt auf die Idee, zwei weitere Vorkommen S. 573 und 885 unter "Pfalzgrafschaft" zu suchen. Es fehlt allerdings die Erwähnung S. 553. Dass die Willibrordskinder im Namensindex zu finden sind, während Nikolauskinder und Peterlinge im Sachindex stehen, ist ebensowenig erfreulich. Es wäre auch sinnvoll gewesen, die jeweiligen Hauptstellen und insbesondere die Zusammenstellung der demographischen Daten im Register hervorzuheben.
Verzichten muss der Leser leider auf die Ortsbeschreibung des Amts Montabaur, die "jeden Rahmen gesprengt hätte" (S. 13). Jeden gedruckten Rahmen wohlgemerkt, ein Digitalisat mit E-Text könnte auch diese Ausarbeitung ohne weiteres zugänglich machen, wie überhaupt - ceterum censeo - zu wünschen ist, dass die Brommerschen Editionen möglichst bald auch als E-Texte online "Open Access" im Internet vorliegen mögen.

Inhaltsverzeichnis als PDF
Nach der positiven Resonanz auf seine Edition des kurtrierischen Feuerbuchs von 1563 (2003) hat sich der Koblenzer Archivar Peter Brommer entschlossen, auch die im Landeshauptarchiv Koblenz vorhandenen kurtrierischen Amtsbeschreibungen herauszugeben. In einem Generalrundschreiben forderte der Erzbischof 1783 die Ämter auf, ausführliche Beschreibungen mit Angaben über Grenzen, innere Verfassung, Gerichtsbarkeiten, fremde Enklaven und Verträge mit Auswärtigen einzureichen, ein Auftrag, den die Ämter äußerst saumselig erfüllten. Als letztes sandte 1792 das Amt Camberg den Bericht ein. Diese Berichte stellen eine großartige landeskundliche Quelle dar, die nunmehr bequem benutzbar ist. Brommer kommentiert die Berichte ausführlich, wobei er für jeden Ort demographische Angaben aus den Archivalien erhoben hat. Das ehemalige Territorium Kurtrier hat somit ein neues Standardwerk erhalten, auf dessen Heranziehung niemand wird verzichten können, der sich forschend mit orts- und landesgeschichtlichen Fragen im Gebiet des nördlichen heutigen Bundeslandes Rheinland-Pfalz befasst.
90 Euro für die beiden Bände ist zwar nicht überteuert, aber für etliche Heimatforscher einfach nicht erschwinglich.
Neben ihrem eher nüchternen statistisch-juristischen Hauptinhalt enthalten die Berichte ab und zu auch spannende Details. Hierzu einige Beispiele:
S. 31 Archäologische Funde in Güls
S. 125 Der "Stumpfe Turm" bei Baldenau wird als "überbleibsel uralter heidnischer architecturen" angesehen. Eine Heidenstadt genannt Sommerburg soll zur Zeit der Hunnen geschleift worden sein.
S. 189 Traditionen zur Kleeburg im Oberamt Boppard.
S. 474 Als Beispiel für die Angaben zur Charaktersistik der Einwohner sei zitiert: "Der Mayener ist gesund und starken leibes, leichtgläubig, eigennützig, hängt den mantel nach dem winde, ist zu aller arbeit geschickt, aber nicht emsig, ist nicht häuslich, vielmehr dem weine sehr ergeben und sehr hitzig".
S. 683 "Der zu Dahlen, pfarr Meud, befindliche einzige protestant in hiesigem amt nahmens Cristian Meyer, von Maxein in dem Hachenburgischen gebürtig, hat sich vor 23 jahren nach Dahlen verheurathet, lasset seine kinder alle katholisch erziehen, haltet dieselbe zum schuhl- und kirchengang strenger an als einer der übrigen pfarrgenossenen, gehet selbst fleisig in die pfarrkirche, ja auch in jene andachten, wo blos das hochwürdige gut verwahret wird, singet und bethet alles ohne ausnahm mit seinen nachbaren, bleibt gleichwohlen immer protestant und haltet alljährlich 1 oder höchstens 2 mal das nachtmahl mit den reformirten zu Maxein". (Eine Gestalt wie aus Hebels Kalendergeschichten, finde ich.)
S. 701 Eine wiederkehrende Neckerei des oberen gegen das untere Kirchspiel Salz (Amt Montabaur) führte immer wieder dazu, dass "sich ortschaft gegen ortschaft, jung und alt in der haaren lagen".
S. 883 Oberamt Münstermaifeld: "Ausser dießen finde in der gerichtsrepositur nichst weithers und sonder bedeutendes ausser der vormahlig hieselbst ausgeübten criminaljurisdiction vermittels im vorigen seculo in jahren 1620 bis 1640 instituirten theils accusations-, theils inquisitionesprocess gegen vorgebliche hechsen und zauberer, so in superstitionen und pactis bestandten haben solle. Die damahlige procedur gefallet mir aber nicht und erachte besser zu sein, daß diese acta verbrennet, alß zum ferneren vorschein kommen sollten."
S. 885f. Überlieferungen zur Maifelder Genoveva und zur Belagerung der Burg Turant.
S. 1121 "Pfahlgraben" (römischer Limes) im Amt Wehrheim.
Mängel weisen die Register auf (erfreulicherweise ist auch ein sehr ausführlicher Sachindex beigegeben). Unter Genovefa, Heilige wird nur die S. 480 ausgeworfen. Niemand kommt auf die Idee, zwei weitere Vorkommen S. 573 und 885 unter "Pfalzgrafschaft" zu suchen. Es fehlt allerdings die Erwähnung S. 553. Dass die Willibrordskinder im Namensindex zu finden sind, während Nikolauskinder und Peterlinge im Sachindex stehen, ist ebensowenig erfreulich. Es wäre auch sinnvoll gewesen, die jeweiligen Hauptstellen und insbesondere die Zusammenstellung der demographischen Daten im Register hervorzuheben.
Verzichten muss der Leser leider auf die Ortsbeschreibung des Amts Montabaur, die "jeden Rahmen gesprengt hätte" (S. 13). Jeden gedruckten Rahmen wohlgemerkt, ein Digitalisat mit E-Text könnte auch diese Ausarbeitung ohne weiteres zugänglich machen, wie überhaupt - ceterum censeo - zu wünschen ist, dass die Brommerschen Editionen möglichst bald auch als E-Texte online "Open Access" im Internet vorliegen mögen.

KlausGraf - am Mittwoch, 24. September 2008, 00:11 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0128-1-2840
Die nur kurz bestehende Zeitschrift kann man als eine Art Vorläufer des "Archivs für mittelrheinische Kirchengeschichte" betrachten:
https://www.mittelrheinische-kirchengeschichte.de/archiv.htm
Die nur kurz bestehende Zeitschrift kann man als eine Art Vorläufer des "Archivs für mittelrheinische Kirchengeschichte" betrachten:
https://www.mittelrheinische-kirchengeschichte.de/archiv.htm
KlausGraf - am Dienstag, 23. September 2008, 18:46 - Rubrik: Landesgeschichte
Friedrich Spee. Priester, Mahner und Poet (1591-1635). Eine
Ausstellung der Diözesan- und Dombibliothek Köln in
Zusammenarbeit mit der Friedrich-Spee-Ges. Düsseldorf 11.
Juni bis 9. Oktober 2008 / Konzeption und Gestaltung der
Ausstellung: Werner Wessel. Weitere Autoren dieses
Begleitheftes [sic!]: Heinz Finger ... – Köln:
Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek 2008 (Libelli
Rhenani Bd. 26). – 494 S. : Ill. – ISBN 978-3-939160-16-8
Preis: 22,00 €, mit Versand € 24,50
In meinem Bücherschrank stehen drei Ausstellungskataloge
über Friedrich Spee: der Stadtbibliothek Trier 1985, des
Düsseldorfer Heine-Instituts 1991 und der ULB Düsseldorf
2000. Das Begleitbuch der Kölner Ausstellung kann das Rad
verständlicherweise nicht neu erfinden, für
wissenschaftliche Zwecke muss man sich hinsichtlich der
Exponatbeschreibungen an die Kataloge von 1985 und 1991
halten, die Einzelnachweise enthalten, auf die man hier im
Katalogteil leider vollständig verzichtet hat.
Ob es unbedingt nötig war, ein neues dickes Buch über Spee,
das noch dazu sehr hagiographisch angelegt ist, zu drucken,
sei dahingestellt, zumal nicht alle Aufsätze von
herausragender Qualität sind. Nützlicher hätte ich es
gefunden, wenn das ersparte Geld in eine
Online-Präsentation gesteckt worden wäre, die ausführlicher
als die bisher vorliegenden kargen Internetangebote die
Spee-Forschung mit Volltexten zu dokumentieren und vor
allem die Hauptwerke als Digitalisate zu präsentieren
hätte. Überfällig wären Digitalisate der Cautio (lateinisch
und deutsch), auch wenn die Übersetzung von Ritter
vergleichsweise wohlfeil bei dtv zu haben ist:
https://www.sehepunkte.de/perform/review.php?id=257
Einsehbar ist an ganzen Werken nur die Ausgabe der
Trutznachtigall von Alfons Weinrich 1908, aber auch nur,
wenn man mit einem US-Proxy umzugehen versteht:
Link
https://tinyurl.com/48exvo
(Ob man diese komplett auch in Deutschland zugänglich
machen dürfte, weiss ich nicht, da mir die Lebensdaten von
Weinrich unbekannt sind. Eine Anfrage bei der
Stadtbibliothek Trier blieb unbeantwortet, während das HAEK
freundlicherweise umgehend mitteilte, Weinrich, der sein
Buch in Köln schrieb, sei offenbar kein Kölner Kleriker
gewesen.)
Erwähnt sei noch, dass der Kölner Ausstellungs-Begleitband
zahlreiche Schwarzweißabbildungen in mäßiger Qualität
enthält.
Kommentiertes Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Vorwort
I. Einzeluntersuchungen
FRIEDRICH SPEES HERKUNFT UND NAME. Die Familie Spee, die
Linie Spee von Langenfeld und die Spee in Kaiserswerth /
Von Heinz Finger S. 13-28
Einzige korrekte Namensform ist "Friedrich Spee", meint
Finger.
FRIEDRICH SPEE UND DER JESUITENORDEN / Von Ursula Kern S.
29-42
FRIEDRICH SPEE – GLAUBENSZEUGE IN TROSTLOSER ZEIT / Von
Gunther Franz S. 43-43-54
Der Vortrag skizziert Leben, Werk und Aktualität Spees.
HEXENVERFOLGUNGEN UND GEGNER DES HEXENWAHNS IM RHEINLAND /
Von Harald Horst S. 55-110
1. Grundlagen der Hexenverfolgungen in Westeuropa
2. Hexenverfolgungen im Kurfürstentum und in der Stadt Köln
3. Gegner des Hexenwahns
Literaturverzeichnis (Quellen, Sekundärliteratur)
Eine brave Kompilation anhand der neueren gedruckten
Literatur, die man vielleicht als Überblick nützlich finden
mag. Kenntnis aller relevanten Literatur erreicht Horst
selbst in seinem Untersuchungsgebiet nicht, denn z.B. zum
Vest Recklinghausen liegt seit 2002 ein Abschnitt bei
Ralf-Peter Fuchs (Hexenverfolgung an Ruhr und Lippe) vor.
Über Spee und seine Cautio handelt Horst (ohne neue
Akzente): S. 95-101.
"AD MAGISTRATUS GERMANIAE HOC TEMPORE NECESSARIUS"
Christliche Obrigkeit, Staat und Menschenrechte bei
Friedrich Spee / Von Gunther Franz S. 111-130
Wiederabdruck aus: Fiat iustitia, 2006, 533-548. Franz geht
auch auf die Cautio ein und zieht das Werk des Jesuiten
Adam Contzen vergleichend heran.
SPEE UND LEIBNIZ. Ein kurzer Überblick / Von Konrad Groß S.
131-140
MISSVERSTANDENE SINNBILDER? / Von Ralf Stefan S. 141-162
"Feststellungen und Beobachtungen anhand eines Vergleichs
von Kupferstichen aus der Pia Desideria des Jesuiten
Hermann Hugo, der Titelzeichnung des Straßburger
Manuskripts der Trutz-Nachtigall von Friedrich Spee und des
Titelkupferstichs der in Köln gedruckten Erstausgabe der
Trutz-Nachtigall"
GEISTLICHE GESÄNGE FRIEDRICH SPEES ALS KIRCHENLIED UND IM
ZYKLUS TRUTZNACHTIGALL / Von Thomas Wichert-Schulze-Gahmen
S. 163-170
DIE POETIKEN VON MARTIN OPITZ UND FRIEDRICH SPEE. Versuch
einer Gegenüberstellung / Von Georg Kühnen S. 171-175
DIE SPRACHE FRIEDRICH SPEES / Von Christoph Hutter S.
176-184
FRIEDRICH SPEE ALS FRAUENSEELSORGER / Von Claudia Hompesch
S. 185-228
Hompesch findet, Spee sei für die Frauen seiner Zeit ein
"Glücksfall" gewesen (S. 225). Sie spricht auch die Frage
an, ob er tatsächlich "Hexenbeichtvater" war und ist
zurecht skeptisch. Wenn Anmerkung 1 eines
wissenschaftlichen Aufsatzes "Quelle: Wikipedia.
Stichworte: Frühe Neuzeit, 17. Jahrhundert" lautet, ist man
gewarnt.
SPEE ALS PÄDAGOGE / Von Oliver Pütz S. 229-257
Spee war Lehrer, Katechet und Erzieher. Pütz versucht
methodische Vorstellungen Spees aus den Übungen des
Tugendbuchs abzuleiten.
FRIEDRICH SPEE UND DIE ROMANTIKER. Ein Beitrag zur
Rezeption von Spees Lyrik in der Jahren 1800-1830 / Von
Konrad Groß S. 258-276
II. Erzbistum, Kurfürstentum und Reichsstadt Köln zu
Lebzeiten Friedrich Spees / Von Heinz Finger S. 277-340
Vorbemerkungen
Einleitung: Erzdiözese, Kurstaat und Stadt Köln und ihr
Verhältnis zueinander, besonders in formaler Hinsicht
1. Die Erzdiözese Köln
2. Das Kurfürstentum Köln
3. Die Stadt Köln
4. Die anderen im Erzbistum Köln gelegenen
Herrschaftsgebiete
5. Das Kurfürstentum Köln und seine Nachbarn in der
internationalen Politik
6. Die Stadt Köln und der Niederrhein in der ersten Hälfte
des Dreißigjährigen Krieges
7. Kurköln und die Kurfürstentümer Mainz und Trier
8. Der Beginn des Kölner Friedenskongresses 1635
9. Die beiden evangelischen Konfessionen im Gebiet des
Erzbistums Köln
Zusammenfassung: Spees Betroffenheit durch
Religionspolitik, gesellschaftlich-kulturellen Wandel,
internationale Politik und Krieg im Rheinland
Eine Überblicksdarstellung zur rheinischen Geschichte, die
dem Sammelband einiges Gewicht verleiht.
III. Katalogteil / Von Werner Wessel S. 341-441
A) FRIEDRICH SPEE – STATIONEN SEINES LEBENS
B) HEILIGENVEREHRUNG BEI FRIEDRICH SPEE
C) DAS GÜLDENE TUGENDBUCH
D) ENGEL IN SPEE-LIEDERN
E) DIE TRUTZNACHTIGALL
F) DER TITELKUPFERSTICH ZUR TRUTZNACHTIGALL
G) SPEE ALS MORALTHEOLOGE
H) DIE CAUTIO CRIMINALIS
I) RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER HEXENVERFOLGUNG
J) WEITERE SCHRIFTEN ZU HEXENVERFOLGUNG UND FOLTER
K) NACHWIRKUNGEN
L) DER JESUIT FRIEDRICH SPEE
M) DAS DENKMAL FÜR SPEE IN KAISERSWERTH
129 Katalognummern.
IV. "Wohlan, so lass uns weiter gehen." Sind Friedrich
Spees Lieder und Meditationen heute noch aktuell? / Von
Hans Müskens S. 443-490
1. Von Schlössern und Riegeln
2. An der Krippe
3. O Traurigkeit, o Herzeleid
4. Trawrgesang von der Noth Christi am Oelberg in dem
Garten
5. Gespräch des gekreuzigten Christus
6. Ist das der Leib, Herr Jesu Christ, der tot im Grab
gelegen ist?
7. Im Schutz des Engels leben
Anhang 1: Joseph Hartzheim in der Bibliotheca Coloniensis
(1747) über Friedrich Spee / Übersetzung von Tina B.
Orth-Müller S. 491f.
Anhang 2: Gedicht von Johannes Baptist Diel S.J. auf P.
Friedrich von Spee S.J. S. 493f.

Ausstellung der Diözesan- und Dombibliothek Köln in
Zusammenarbeit mit der Friedrich-Spee-Ges. Düsseldorf 11.
Juni bis 9. Oktober 2008 / Konzeption und Gestaltung der
Ausstellung: Werner Wessel. Weitere Autoren dieses
Begleitheftes [sic!]: Heinz Finger ... – Köln:
Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek 2008 (Libelli
Rhenani Bd. 26). – 494 S. : Ill. – ISBN 978-3-939160-16-8
Preis: 22,00 €, mit Versand € 24,50
In meinem Bücherschrank stehen drei Ausstellungskataloge
über Friedrich Spee: der Stadtbibliothek Trier 1985, des
Düsseldorfer Heine-Instituts 1991 und der ULB Düsseldorf
2000. Das Begleitbuch der Kölner Ausstellung kann das Rad
verständlicherweise nicht neu erfinden, für
wissenschaftliche Zwecke muss man sich hinsichtlich der
Exponatbeschreibungen an die Kataloge von 1985 und 1991
halten, die Einzelnachweise enthalten, auf die man hier im
Katalogteil leider vollständig verzichtet hat.
Ob es unbedingt nötig war, ein neues dickes Buch über Spee,
das noch dazu sehr hagiographisch angelegt ist, zu drucken,
sei dahingestellt, zumal nicht alle Aufsätze von
herausragender Qualität sind. Nützlicher hätte ich es
gefunden, wenn das ersparte Geld in eine
Online-Präsentation gesteckt worden wäre, die ausführlicher
als die bisher vorliegenden kargen Internetangebote die
Spee-Forschung mit Volltexten zu dokumentieren und vor
allem die Hauptwerke als Digitalisate zu präsentieren
hätte. Überfällig wären Digitalisate der Cautio (lateinisch
und deutsch), auch wenn die Übersetzung von Ritter
vergleichsweise wohlfeil bei dtv zu haben ist:
https://www.sehepunkte.de/perform/review.php?id=257
Einsehbar ist an ganzen Werken nur die Ausgabe der
Trutznachtigall von Alfons Weinrich 1908, aber auch nur,
wenn man mit einem US-Proxy umzugehen versteht:
Link
https://tinyurl.com/48exvo
(Ob man diese komplett auch in Deutschland zugänglich
machen dürfte, weiss ich nicht, da mir die Lebensdaten von
Weinrich unbekannt sind. Eine Anfrage bei der
Stadtbibliothek Trier blieb unbeantwortet, während das HAEK
freundlicherweise umgehend mitteilte, Weinrich, der sein
Buch in Köln schrieb, sei offenbar kein Kölner Kleriker
gewesen.)
Erwähnt sei noch, dass der Kölner Ausstellungs-Begleitband
zahlreiche Schwarzweißabbildungen in mäßiger Qualität
enthält.
Kommentiertes Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Vorwort
I. Einzeluntersuchungen
FRIEDRICH SPEES HERKUNFT UND NAME. Die Familie Spee, die
Linie Spee von Langenfeld und die Spee in Kaiserswerth /
Von Heinz Finger S. 13-28
Einzige korrekte Namensform ist "Friedrich Spee", meint
Finger.
FRIEDRICH SPEE UND DER JESUITENORDEN / Von Ursula Kern S.
29-42
FRIEDRICH SPEE – GLAUBENSZEUGE IN TROSTLOSER ZEIT / Von
Gunther Franz S. 43-43-54
Der Vortrag skizziert Leben, Werk und Aktualität Spees.
HEXENVERFOLGUNGEN UND GEGNER DES HEXENWAHNS IM RHEINLAND /
Von Harald Horst S. 55-110
1. Grundlagen der Hexenverfolgungen in Westeuropa
2. Hexenverfolgungen im Kurfürstentum und in der Stadt Köln
3. Gegner des Hexenwahns
Literaturverzeichnis (Quellen, Sekundärliteratur)
Eine brave Kompilation anhand der neueren gedruckten
Literatur, die man vielleicht als Überblick nützlich finden
mag. Kenntnis aller relevanten Literatur erreicht Horst
selbst in seinem Untersuchungsgebiet nicht, denn z.B. zum
Vest Recklinghausen liegt seit 2002 ein Abschnitt bei
Ralf-Peter Fuchs (Hexenverfolgung an Ruhr und Lippe) vor.
Über Spee und seine Cautio handelt Horst (ohne neue
Akzente): S. 95-101.
"AD MAGISTRATUS GERMANIAE HOC TEMPORE NECESSARIUS"
Christliche Obrigkeit, Staat und Menschenrechte bei
Friedrich Spee / Von Gunther Franz S. 111-130
Wiederabdruck aus: Fiat iustitia, 2006, 533-548. Franz geht
auch auf die Cautio ein und zieht das Werk des Jesuiten
Adam Contzen vergleichend heran.
SPEE UND LEIBNIZ. Ein kurzer Überblick / Von Konrad Groß S.
131-140
MISSVERSTANDENE SINNBILDER? / Von Ralf Stefan S. 141-162
"Feststellungen und Beobachtungen anhand eines Vergleichs
von Kupferstichen aus der Pia Desideria des Jesuiten
Hermann Hugo, der Titelzeichnung des Straßburger
Manuskripts der Trutz-Nachtigall von Friedrich Spee und des
Titelkupferstichs der in Köln gedruckten Erstausgabe der
Trutz-Nachtigall"
GEISTLICHE GESÄNGE FRIEDRICH SPEES ALS KIRCHENLIED UND IM
ZYKLUS TRUTZNACHTIGALL / Von Thomas Wichert-Schulze-Gahmen
S. 163-170
DIE POETIKEN VON MARTIN OPITZ UND FRIEDRICH SPEE. Versuch
einer Gegenüberstellung / Von Georg Kühnen S. 171-175
DIE SPRACHE FRIEDRICH SPEES / Von Christoph Hutter S.
176-184
FRIEDRICH SPEE ALS FRAUENSEELSORGER / Von Claudia Hompesch
S. 185-228
Hompesch findet, Spee sei für die Frauen seiner Zeit ein
"Glücksfall" gewesen (S. 225). Sie spricht auch die Frage
an, ob er tatsächlich "Hexenbeichtvater" war und ist
zurecht skeptisch. Wenn Anmerkung 1 eines
wissenschaftlichen Aufsatzes "Quelle: Wikipedia.
Stichworte: Frühe Neuzeit, 17. Jahrhundert" lautet, ist man
gewarnt.
SPEE ALS PÄDAGOGE / Von Oliver Pütz S. 229-257
Spee war Lehrer, Katechet und Erzieher. Pütz versucht
methodische Vorstellungen Spees aus den Übungen des
Tugendbuchs abzuleiten.
FRIEDRICH SPEE UND DIE ROMANTIKER. Ein Beitrag zur
Rezeption von Spees Lyrik in der Jahren 1800-1830 / Von
Konrad Groß S. 258-276
II. Erzbistum, Kurfürstentum und Reichsstadt Köln zu
Lebzeiten Friedrich Spees / Von Heinz Finger S. 277-340
Vorbemerkungen
Einleitung: Erzdiözese, Kurstaat und Stadt Köln und ihr
Verhältnis zueinander, besonders in formaler Hinsicht
1. Die Erzdiözese Köln
2. Das Kurfürstentum Köln
3. Die Stadt Köln
4. Die anderen im Erzbistum Köln gelegenen
Herrschaftsgebiete
5. Das Kurfürstentum Köln und seine Nachbarn in der
internationalen Politik
6. Die Stadt Köln und der Niederrhein in der ersten Hälfte
des Dreißigjährigen Krieges
7. Kurköln und die Kurfürstentümer Mainz und Trier
8. Der Beginn des Kölner Friedenskongresses 1635
9. Die beiden evangelischen Konfessionen im Gebiet des
Erzbistums Köln
Zusammenfassung: Spees Betroffenheit durch
Religionspolitik, gesellschaftlich-kulturellen Wandel,
internationale Politik und Krieg im Rheinland
Eine Überblicksdarstellung zur rheinischen Geschichte, die
dem Sammelband einiges Gewicht verleiht.
III. Katalogteil / Von Werner Wessel S. 341-441
A) FRIEDRICH SPEE – STATIONEN SEINES LEBENS
B) HEILIGENVEREHRUNG BEI FRIEDRICH SPEE
C) DAS GÜLDENE TUGENDBUCH
D) ENGEL IN SPEE-LIEDERN
E) DIE TRUTZNACHTIGALL
F) DER TITELKUPFERSTICH ZUR TRUTZNACHTIGALL
G) SPEE ALS MORALTHEOLOGE
H) DIE CAUTIO CRIMINALIS
I) RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER HEXENVERFOLGUNG
J) WEITERE SCHRIFTEN ZU HEXENVERFOLGUNG UND FOLTER
K) NACHWIRKUNGEN
L) DER JESUIT FRIEDRICH SPEE
M) DAS DENKMAL FÜR SPEE IN KAISERSWERTH
129 Katalognummern.
IV. "Wohlan, so lass uns weiter gehen." Sind Friedrich
Spees Lieder und Meditationen heute noch aktuell? / Von
Hans Müskens S. 443-490
1. Von Schlössern und Riegeln
2. An der Krippe
3. O Traurigkeit, o Herzeleid
4. Trawrgesang von der Noth Christi am Oelberg in dem
Garten
5. Gespräch des gekreuzigten Christus
6. Ist das der Leib, Herr Jesu Christ, der tot im Grab
gelegen ist?
7. Im Schutz des Engels leben
Anhang 1: Joseph Hartzheim in der Bibliotheca Coloniensis
(1747) über Friedrich Spee / Übersetzung von Tina B.
Orth-Müller S. 491f.
Anhang 2: Gedicht von Johannes Baptist Diel S.J. auf P.
Friedrich von Spee S.J. S. 493f.

KlausGraf - am Dienstag, 23. September 2008, 01:20 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5781/
Graf, Klaus: Beiträge zur Adelsgeschichte des Heubacher Raums, in: Heubach und die Burg Rosenstein, Schwäbisch Gmünd 1984, S. 76-89, 405-409
Kurzfassung in Deutsch
Der Beitrag gilt erstens der Frage nach der Heimat Bischof Ottos I. des Heiligen von Bamberg (1102-1139). Die zuletzt von Heinz Bühler vertretene Auffassung, Otto sei ein Sohn der Schwester Adelheid des ersten Stauferherzogs Friedrich gewesen, wird zurückgewiesen. Im zweiten Abschnitt wird kritisch Stellung bezogen zu den von Hans Jänichen und Heinz Bühler formulierten Hypothesen über die am Anfang des 12. Jahrhunderts belegten Herren von Michelstein. Völlig ungesichert ist deren Zuweisung zu einem Burgstall bei Sontheim (Albuch). Etwas wahrscheinlicher nannten sie sich nach einer Burg bei Egesheim (Landkreis Tuttlingen). Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit dem Haus der Schwäbischen Pfalzgrafen von Lauterburg, den Grafen von Dillingen und zwei möglichen Reminiszenzen der pfalzgräflichen Herrschaft bei Heubach (Pfalzplatz bei Lautern, Fahnenwappen der Herren von Rosenstein/Heubach). Im vierten Abschnitt werden die bekanntgewordenen Belege der Herren von Heubach und Rosenstein im 13. und 14. Jahrhundert vorgestellt. Fünftens wird eine Aufzeichnung zum adeligen Selbstverständnis der Herren von Rechberg aus dem 15. oder 16. Jahrhundert (?), betreffend die Speyerer Bischöfe Rapoto und Ulrich II. ediert und besprochen, die um 1800 bei Joseph Alois Rink mit der Quellenangabe überliefert wird, es handle sich um den Text eines in Bruchsal befindlichen alten speyerischen Manuskriptes. Der sechste Abschnitt weist auf die Existenz und mögliche politische Bedeutung von im 14. Jahrhundert im Raum um Gmünd, Heubach und Aalen agierenden Niederadelsgruppen hin. Angesprochen werden auch die Beziehungen dieser Adeligen am unteren Rand zu den Städten Gmünd und Aalen.
PDF mit leicht korrigierter OCR. Zu den Abschnitten 2 und 3: Klaus Graf, Lautern und die Herrschaft Lauterburg, in: Freundliches Lautern. Geschichte und Geschichten von Heubach/Lautern im Ostalbkreis, bearb. von Gerhard Kolb, Schwäbisch Gmünd 1995, S. 147-157, 219-220. Dort wird in einer Anmerkung (S. 220 Anm. 18) zu der in Abschnitt 5 behandelten Quelle die Vermutung ausgesprochen, dass es sich um eine Fälschung der Zeit um 1800 handelt. Siehe auch
https://projekte.geschichte.uni-freiburg.de/mertens/graf/gdabst.htm#ost

Graf, Klaus: Beiträge zur Adelsgeschichte des Heubacher Raums, in: Heubach und die Burg Rosenstein, Schwäbisch Gmünd 1984, S. 76-89, 405-409
Kurzfassung in Deutsch
Der Beitrag gilt erstens der Frage nach der Heimat Bischof Ottos I. des Heiligen von Bamberg (1102-1139). Die zuletzt von Heinz Bühler vertretene Auffassung, Otto sei ein Sohn der Schwester Adelheid des ersten Stauferherzogs Friedrich gewesen, wird zurückgewiesen. Im zweiten Abschnitt wird kritisch Stellung bezogen zu den von Hans Jänichen und Heinz Bühler formulierten Hypothesen über die am Anfang des 12. Jahrhunderts belegten Herren von Michelstein. Völlig ungesichert ist deren Zuweisung zu einem Burgstall bei Sontheim (Albuch). Etwas wahrscheinlicher nannten sie sich nach einer Burg bei Egesheim (Landkreis Tuttlingen). Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit dem Haus der Schwäbischen Pfalzgrafen von Lauterburg, den Grafen von Dillingen und zwei möglichen Reminiszenzen der pfalzgräflichen Herrschaft bei Heubach (Pfalzplatz bei Lautern, Fahnenwappen der Herren von Rosenstein/Heubach). Im vierten Abschnitt werden die bekanntgewordenen Belege der Herren von Heubach und Rosenstein im 13. und 14. Jahrhundert vorgestellt. Fünftens wird eine Aufzeichnung zum adeligen Selbstverständnis der Herren von Rechberg aus dem 15. oder 16. Jahrhundert (?), betreffend die Speyerer Bischöfe Rapoto und Ulrich II. ediert und besprochen, die um 1800 bei Joseph Alois Rink mit der Quellenangabe überliefert wird, es handle sich um den Text eines in Bruchsal befindlichen alten speyerischen Manuskriptes. Der sechste Abschnitt weist auf die Existenz und mögliche politische Bedeutung von im 14. Jahrhundert im Raum um Gmünd, Heubach und Aalen agierenden Niederadelsgruppen hin. Angesprochen werden auch die Beziehungen dieser Adeligen am unteren Rand zu den Städten Gmünd und Aalen.
PDF mit leicht korrigierter OCR. Zu den Abschnitten 2 und 3: Klaus Graf, Lautern und die Herrschaft Lauterburg, in: Freundliches Lautern. Geschichte und Geschichten von Heubach/Lautern im Ostalbkreis, bearb. von Gerhard Kolb, Schwäbisch Gmünd 1995, S. 147-157, 219-220. Dort wird in einer Anmerkung (S. 220 Anm. 18) zu der in Abschnitt 5 behandelten Quelle die Vermutung ausgesprochen, dass es sich um eine Fälschung der Zeit um 1800 handelt. Siehe auch
https://projekte.geschichte.uni-freiburg.de/mertens/graf/gdabst.htm#ost

KlausGraf - am Montag, 15. September 2008, 18:43 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Offizielle Seite der Landesausstellung:
https://www.hdbg.de/adel/index.php
Literaturverzeichnis des Stadtarchivs Rosenheim:
https://www.stadtarchiv.de/fileadmin/aktuelles/Literaturverzeichnis_Adel_in_Bayern.pdf
Das Ausstellungs-Sudoku ist von der Usability verbesserungsfähig. Hat man es gelöst, muss man rechts auf Lösung klicken. Ob man richtig lag, bekommt man nicht gesagt:
https://www.hdbg.de/adel/adel_sudoku.php
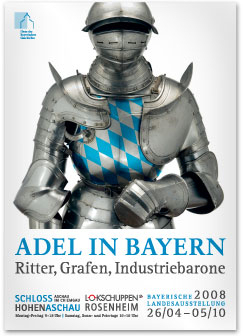
https://www.hdbg.de/adel/index.php
Literaturverzeichnis des Stadtarchivs Rosenheim:
https://www.stadtarchiv.de/fileadmin/aktuelles/Literaturverzeichnis_Adel_in_Bayern.pdf
Das Ausstellungs-Sudoku ist von der Usability verbesserungsfähig. Hat man es gelöst, muss man rechts auf Lösung klicken. Ob man richtig lag, bekommt man nicht gesagt:
https://www.hdbg.de/adel/adel_sudoku.php
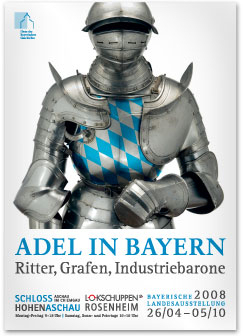
KlausGraf - am Sonntag, 31. August 2008, 18:14 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Im Vorwort zum brandneuen Buch über die Waldburg schreibt Georg Fürst von Waldburg-Zeil:
„Viele Menschen in unserer Heimat sind dieser Geschichte eng verbunden und leben heute noch im hohem Maße im Bewusstsein des Erbes ihrer Väter, das in so vielfältigen Werken der Religion, der Kunst und der Kultur auf uns gekommen ist.“
Ist der Satz etwa ein Seitenhieb des Autors? Wohl kaum, aber er passt wie die Faust aufs Auge. Gleich rechts daneben blickt uns nämlich der Schreiber des zweiten Vorworts an: Johannes Fürst zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee, Ausverkäufer seines Besitzes, der immerhin in den letzten Jahren die zwei bedeutendsten Stücke seiner Sammlung verscherbelt hat, die Waldseemüller-Karte und das Mittelalterliche Hausbuch. Ein perfekter Adressat für diese Worte.
Das als „erste umfassende Darstellung der Waldburg“ angekündigte Buch, das von Max Graf zu Waldburg-Wolfegg, Vetter von Georg und Onkel von Johannes, herausgegeben wurde, möchte ich allerdings schon nach dem ersten Durchblättern allen Waldburgern und sonstigen Oberschwaben empfehlen, denen der Sinn für Kultur und Geschichte noch nicht abhandengekommen ist. Schon der 110seitige Aufsatz zu Baubestand und Baugeschichte der Waldburg von Stefan Uhl ist das Geld wohl mehr als wert.
In der Ankündigung des Verlags war noch von 384 Seiten und „zahlreichen Biographien“ die Rede. Nun sind es 215 Seiten, und Biographien sind es auch bei wohlwollender Zählung nur fünf. Bleibt da zu hoffen, dass in absehbarer Zeit doch einmal ein Überblicksband über die Geschichte der Familie und ihrer Zweige erscheint? Seit Vochezers „Geschichte“ (1888–1907) ist ja nichts derartiges mehr in Angriff genommen worden.

Max Graf zu Waldburg-Wolfegg (Hrsg.): ''Die Waldburg in Schwaben''.
215 Seiten, zahlr. farb. Abbildungen
Jan Thorbecke, Ostfildern 2008
ISBN 978-3-7995-1069-1
Euro 29,80
„Viele Menschen in unserer Heimat sind dieser Geschichte eng verbunden und leben heute noch im hohem Maße im Bewusstsein des Erbes ihrer Väter, das in so vielfältigen Werken der Religion, der Kunst und der Kultur auf uns gekommen ist.“
Ist der Satz etwa ein Seitenhieb des Autors? Wohl kaum, aber er passt wie die Faust aufs Auge. Gleich rechts daneben blickt uns nämlich der Schreiber des zweiten Vorworts an: Johannes Fürst zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee, Ausverkäufer seines Besitzes, der immerhin in den letzten Jahren die zwei bedeutendsten Stücke seiner Sammlung verscherbelt hat, die Waldseemüller-Karte und das Mittelalterliche Hausbuch. Ein perfekter Adressat für diese Worte.
Das als „erste umfassende Darstellung der Waldburg“ angekündigte Buch, das von Max Graf zu Waldburg-Wolfegg, Vetter von Georg und Onkel von Johannes, herausgegeben wurde, möchte ich allerdings schon nach dem ersten Durchblättern allen Waldburgern und sonstigen Oberschwaben empfehlen, denen der Sinn für Kultur und Geschichte noch nicht abhandengekommen ist. Schon der 110seitige Aufsatz zu Baubestand und Baugeschichte der Waldburg von Stefan Uhl ist das Geld wohl mehr als wert.
In der Ankündigung des Verlags war noch von 384 Seiten und „zahlreichen Biographien“ die Rede. Nun sind es 215 Seiten, und Biographien sind es auch bei wohlwollender Zählung nur fünf. Bleibt da zu hoffen, dass in absehbarer Zeit doch einmal ein Überblicksband über die Geschichte der Familie und ihrer Zweige erscheint? Seit Vochezers „Geschichte“ (1888–1907) ist ja nichts derartiges mehr in Angriff genommen worden.

Max Graf zu Waldburg-Wolfegg (Hrsg.): ''Die Waldburg in Schwaben''.
215 Seiten, zahlr. farb. Abbildungen
Jan Thorbecke, Ostfildern 2008
ISBN 978-3-7995-1069-1
Euro 29,80
Ladislaus - am Mittwoch, 20. August 2008, 19:56 - Rubrik: Landesgeschichte