Landesgeschichte
Eine bemerkenswerte Studie liegt online vor.
https://othes.univie.ac.at/5159/
Dokumentenart: Hochschulschrift (Dissertation)
AutorInnen: Bruckner, Eva
Titel: Formen der Herrschaftsrepräsentation und Selbstdarstellung habsburgischer Fürsten im Spätmittelalter
Umfangsangabe: 404
Institution: Universität Wien
Fakultät: Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
Publikationsjahr: 2009
Klassifikation: 15 Geschichte > 15.33 Hoch- und Spätmittelalter
Schlagwörter in Deutsch: Repräsentation / Selbstdarstellung / Bild / Habsburger / Spätmittelalter
Abstract in Deutsch: Die Dissertation untersucht die Formen der Herrschaftsrepräsentation und Selbstdarstellung habsburgischer Fürsten im Zeitraum zwischen 1365 und 1496 unter besonderer Berücksichtigung der Bilder und Objekte aus historischer Sicht. Behandelt werden die visuellen Mittel der Herrschaftspropaganda von insgesamt zwölf Fürsten aus der albertinischen, der leopoldinischen und der Tiroler Linie der Dynastie. Der in dieser Arbeit bewusst weit gefasste Bildbegriff geht über den kunsthistorischen hinaus und ermöglicht es, sowohl dingliche Quellen als auch ephemere Bilder in die Untersuchung mit einzubeziehen. Aus Gründen der Vergleichbarkeit werden ausschließlich zeitgenössische Quellen oder originalgetreue Kopien derselben herangezogen. Das innerhalb der einzelnen Kapitel nach Themenbereichen chronologisch gereihte Datenmaterial und die katalogartige Aufbereitung geben einen Überblick über die Repräsentationsformen der spätmittelalterlichen habsburgischen Fürsten und veranschaulichen Kontinuität und Wandel innerhalb der Familienzweige. Mehreren der hier angeführten visuellen Medien kommt auch insofern Bedeutung zu, als sie das erstmalige Auftreten bestimmter Bildmotive auf den Trägern der Herrschaftspropaganda der Habsburger dokumentieren. So erscheint z.B. auf einem Kreuzer Herzog Leopolds III. erstmals der Dux-Titel in der Umschrift eines Tiroler Gepräges der Dynastie; auf dem königlichen Wappensiegel Albrechts II. ist zum ersten Mal ein quadrierter Schild dargestellt; das erste datierte Thronsiegel stammt von König Ladislaus aus dem Jahr 1454 usw. Es sind besonders Profan- und Sakralbauten, Wappensteine, gemalte Porträts, Urkunden, Siegel, Münzen, Zeichen adeliger bzw. ritterlicher Gesellschaften, illuminierte Handschriften, Altäre, Kleinodien, Rüstzeug und Grabmäler, welche die Fürsten in den Dienst ihrer herrscherlichen Repräsentation stellen. Ikonographisch dominieren religiöse und heraldische Bildmotive. Weiters zeigt sich, dass erstmals 1403 und ab 1414 kontinuierlich der Erzherzogstitel mit der entsprechenden Insignie in der Bildpropaganda der Fürsten an Bedeutung gewinnt. Die schriftlich vielfach belegten feierlichen Zeremonien dienen der Legitimation wie auch der Machtdemonstration und erlauben glanzvolle Auftritte vor versammelter Menge. Sie finden in der Regel an traditionsreichen Orten und an hohen Festtagen unter Einhaltung bestimmter Rituale statt. Besonders prestigeträchtige Ereignisse sind Einzüge in Städte, Fernreisen, um den Ritterschlag zu erhalten, Wallfahrten und Pilgerreisen, Huldigungen, Belehnungen und Krönungen, Feste anlässlich des Besuchs hoher Gäste und Familienfeiern wie Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse. Den zeitgenössischen Berichten zufolge bilden zum Teil aufwendige Ritterspiele und Turniere am Burg- oder Marktplatz der Stadt einen fixen Programmpunkt bei fast allen Festivitäten. Die im Ablauf dieser feierlichen Handlungen entstehenden Bilder und Impressionen sind aufgrund ihres vergänglichen Charakters nicht erhalten. Um sie zu rekonstruieren, bedarf es auch unserer Vorstellungskraft. Die Dissertation veranschaulicht zudem die Vorbildwirkung der Herrscherpropaganda Herzog Rudolfs IV. auf die Repräsentation der hier behandelten Fürsten. Viele Elemente seiner Bildpropaganda finden sich in den Mitteln der Repräsentation seiner Nachfolger und zeigen in den visuellen Medien Herzog Ernsts des Eisernen ihre erste starke Ausprägung. Herzog Friedrich V. (IV., III.) übernimmt in der Folge die Imitatio Rudolfi für seine fürstliche Repräsentation und realisiert die meisten der damit verbundenen politischen Ansprüche.
https://othes.univie.ac.at/5159/
Dokumentenart: Hochschulschrift (Dissertation)
AutorInnen: Bruckner, Eva
Titel: Formen der Herrschaftsrepräsentation und Selbstdarstellung habsburgischer Fürsten im Spätmittelalter
Umfangsangabe: 404
Institution: Universität Wien
Fakultät: Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
Publikationsjahr: 2009
Klassifikation: 15 Geschichte > 15.33 Hoch- und Spätmittelalter
Schlagwörter in Deutsch: Repräsentation / Selbstdarstellung / Bild / Habsburger / Spätmittelalter
Abstract in Deutsch: Die Dissertation untersucht die Formen der Herrschaftsrepräsentation und Selbstdarstellung habsburgischer Fürsten im Zeitraum zwischen 1365 und 1496 unter besonderer Berücksichtigung der Bilder und Objekte aus historischer Sicht. Behandelt werden die visuellen Mittel der Herrschaftspropaganda von insgesamt zwölf Fürsten aus der albertinischen, der leopoldinischen und der Tiroler Linie der Dynastie. Der in dieser Arbeit bewusst weit gefasste Bildbegriff geht über den kunsthistorischen hinaus und ermöglicht es, sowohl dingliche Quellen als auch ephemere Bilder in die Untersuchung mit einzubeziehen. Aus Gründen der Vergleichbarkeit werden ausschließlich zeitgenössische Quellen oder originalgetreue Kopien derselben herangezogen. Das innerhalb der einzelnen Kapitel nach Themenbereichen chronologisch gereihte Datenmaterial und die katalogartige Aufbereitung geben einen Überblick über die Repräsentationsformen der spätmittelalterlichen habsburgischen Fürsten und veranschaulichen Kontinuität und Wandel innerhalb der Familienzweige. Mehreren der hier angeführten visuellen Medien kommt auch insofern Bedeutung zu, als sie das erstmalige Auftreten bestimmter Bildmotive auf den Trägern der Herrschaftspropaganda der Habsburger dokumentieren. So erscheint z.B. auf einem Kreuzer Herzog Leopolds III. erstmals der Dux-Titel in der Umschrift eines Tiroler Gepräges der Dynastie; auf dem königlichen Wappensiegel Albrechts II. ist zum ersten Mal ein quadrierter Schild dargestellt; das erste datierte Thronsiegel stammt von König Ladislaus aus dem Jahr 1454 usw. Es sind besonders Profan- und Sakralbauten, Wappensteine, gemalte Porträts, Urkunden, Siegel, Münzen, Zeichen adeliger bzw. ritterlicher Gesellschaften, illuminierte Handschriften, Altäre, Kleinodien, Rüstzeug und Grabmäler, welche die Fürsten in den Dienst ihrer herrscherlichen Repräsentation stellen. Ikonographisch dominieren religiöse und heraldische Bildmotive. Weiters zeigt sich, dass erstmals 1403 und ab 1414 kontinuierlich der Erzherzogstitel mit der entsprechenden Insignie in der Bildpropaganda der Fürsten an Bedeutung gewinnt. Die schriftlich vielfach belegten feierlichen Zeremonien dienen der Legitimation wie auch der Machtdemonstration und erlauben glanzvolle Auftritte vor versammelter Menge. Sie finden in der Regel an traditionsreichen Orten und an hohen Festtagen unter Einhaltung bestimmter Rituale statt. Besonders prestigeträchtige Ereignisse sind Einzüge in Städte, Fernreisen, um den Ritterschlag zu erhalten, Wallfahrten und Pilgerreisen, Huldigungen, Belehnungen und Krönungen, Feste anlässlich des Besuchs hoher Gäste und Familienfeiern wie Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse. Den zeitgenössischen Berichten zufolge bilden zum Teil aufwendige Ritterspiele und Turniere am Burg- oder Marktplatz der Stadt einen fixen Programmpunkt bei fast allen Festivitäten. Die im Ablauf dieser feierlichen Handlungen entstehenden Bilder und Impressionen sind aufgrund ihres vergänglichen Charakters nicht erhalten. Um sie zu rekonstruieren, bedarf es auch unserer Vorstellungskraft. Die Dissertation veranschaulicht zudem die Vorbildwirkung der Herrscherpropaganda Herzog Rudolfs IV. auf die Repräsentation der hier behandelten Fürsten. Viele Elemente seiner Bildpropaganda finden sich in den Mitteln der Repräsentation seiner Nachfolger und zeigen in den visuellen Medien Herzog Ernsts des Eisernen ihre erste starke Ausprägung. Herzog Friedrich V. (IV., III.) übernimmt in der Folge die Imitatio Rudolfi für seine fürstliche Repräsentation und realisiert die meisten der damit verbundenen politischen Ansprüche.
KlausGraf - am Dienstag, 30. Juni 2009, 23:46 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
URN: urn:nbn:de:bsz:25-opus-66252
URL: https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6625/
https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6625/pdf/Graf_Mandat.pdf
Graf, Klaus
Ein verlorenes Mandat Kaiser Friedrichs II. zugunsten von Kloster Adelberg
pdf-Format:
Dokument 1.pdf (636 KB)
Kurzfassung in Deutsch
Eine von dem württembergischen Altertumsforscher Andreas Rüttel d. Ä. angelegte Sammelhandschrift der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe (Günterstal 11) überliefert S. 6 das lateinische Kurzregest eines nicht mehr erhaltenen Mandats, ausgestellt von König Friedrich II. in Schwäbisch Hall am 16. Juni 1220. Es befiehlt den Schultheißen von Esslingen und Gmünd den Schutz des Klosters Adelberg. Im zweiten Teil des Beitrags werden Überlegungen zur Verwaltungsorganisation der späten Stauferzeit, insbesondere zur Königsnähe der Amtsträger, und zur Förderung der Reichslandstädte als Vororte und Herrschaftsmittelpunkte zur Diskussion gestellt.
SWD-Schlagwörter: Schwäbisch Gmünd , Adelberg / Stift , Staufer
Freie Schlagwörter (deutsch): Stadtgeschichte , Reichslandstädte
Institut: Historisches Seminar
DDC-Sachgruppe: Geschichte
Dokumentart: Aufsatz
Quelle: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 43 (1984), S. 407-414
Sprache: Deutsch
Erstellungsjahr: 1984
Publikationsdatum: 24.06.2009
Bemerkung: PDF mit leicht korrigierter OCR
Text des Rüttel-Regests:
Fridericus rex Romanorum et Sicilie precepit scultecis de Eslingen et Gmund ut commendatum habeant claustrum Adelberg eo quod a progenitoribus suis dotatum parite[r] et fundatum et ipse illud sub specialem maiestatis sue protectionem cum omnibus bonis receperit. Actum apud Hall(am) XIV kalendas Julii indictione octava.
URL: https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6625/
https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6625/pdf/Graf_Mandat.pdf
Graf, Klaus
Ein verlorenes Mandat Kaiser Friedrichs II. zugunsten von Kloster Adelberg
pdf-Format:
Dokument 1.pdf (636 KB)
Kurzfassung in Deutsch
Eine von dem württembergischen Altertumsforscher Andreas Rüttel d. Ä. angelegte Sammelhandschrift der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe (Günterstal 11) überliefert S. 6 das lateinische Kurzregest eines nicht mehr erhaltenen Mandats, ausgestellt von König Friedrich II. in Schwäbisch Hall am 16. Juni 1220. Es befiehlt den Schultheißen von Esslingen und Gmünd den Schutz des Klosters Adelberg. Im zweiten Teil des Beitrags werden Überlegungen zur Verwaltungsorganisation der späten Stauferzeit, insbesondere zur Königsnähe der Amtsträger, und zur Förderung der Reichslandstädte als Vororte und Herrschaftsmittelpunkte zur Diskussion gestellt.
SWD-Schlagwörter: Schwäbisch Gmünd , Adelberg / Stift , Staufer
Freie Schlagwörter (deutsch): Stadtgeschichte , Reichslandstädte
Institut: Historisches Seminar
DDC-Sachgruppe: Geschichte
Dokumentart: Aufsatz
Quelle: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 43 (1984), S. 407-414
Sprache: Deutsch
Erstellungsjahr: 1984
Publikationsdatum: 24.06.2009
Bemerkung: PDF mit leicht korrigierter OCR
Text des Rüttel-Regests:
Fridericus rex Romanorum et Sicilie precepit scultecis de Eslingen et Gmund ut commendatum habeant claustrum Adelberg eo quod a progenitoribus suis dotatum parite[r] et fundatum et ipse illud sub specialem maiestatis sue protectionem cum omnibus bonis receperit. Actum apud Hall(am) XIV kalendas Julii indictione octava.
KlausGraf - am Donnerstag, 25. Juni 2009, 13:57 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.mittelbayerische.de/index.cfm?pid=1310&pk=177363&opv=snd
Parsberg ist keine 1000, sondern 800 Jahre alt: Dies ist bei einem Pressegespräch mit Burgmuseumsleiter Theo Döllinger und Fördervereinsvorsitzendem Helmut Jobst einmal mehr deutlich geworden. Das Museum besitzt seit kurzem eine Urkundenkopie aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv München, die angeblich aus den Jahren 1318 und 1340 stammen sollen. Darin wird bescheinigt, dass „die Parsberger Rechte schon seit 385 Jahren bestehen“.
Archivoberrat Reiprich schreibt an das Burgmuseum: „Die Rechnung, dass Parsberg schon im Jahre 933 bestand, geht von falschen Voraussetzungen aus, nämlich von zwei gefälschten Urkunden, angeblich aus den Jahren 1318 und 1340. Die von 1340 des Kaisers Ludwig des Bayern, die von den damals seit 407 Jahren bestehenden Parsberger Rechten spricht, ist ebenso eine Fälschung, wie die von 1318, die in Amberg liegt.“
Nun bestehen die Parsberger seit Jahren auf der so genannten „Spitzner-Chronik“, die sich auf das Turnierbuch des Georg Rüxner (Rixner) stützt, das dieser 1532 verfasst hat. „Die Spitzner-Chronik ist eine saubere und diffizile Arbeit und soll auch erhalten werden, aber sie ändert nichts an der Tatsache, dass Parsberg 933 noch nicht bestanden hat“, sagt Jobst. Dies habe auch Professor Dr. Alois Schmid in seinen Nachforschungen „Parsberg im Herzogtum der frühen Wittelsbacher“ bescheinigt.
Döllinger fügt hinzu, dass dies bereits der Historiker Manfred Jehle in seinem „Historischen Atlas Bayern“ festgestellt habe. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit der Genehmigung von Bertl Spitzner diese Chronik mit einem Anhang fortzuführen und Unwahrheiten zurechtrücken.“
Der damalige Vortrag von Dr. Schmid (7. Oktober 2005) in Parsberg hat aber weitere Hobby-Forscher auf den Plan gerufen. So hat Alois Dechant die Sache in die Hand genommen und Fragen an die Archive der Städte Magdeburg, Zürich und Nürnberg geschickt – wegen Ritterturnieren, an denen Parsberger genommen haben sollen.
https://archiv.twoday.net/search?q=rüxner
Von einer sauberen Arbeit kann hinsichtlich der Spitzner-Chronik zuallerletzt die Rede sein:
https://www.parsberg.de/fileadmin/downloads/chronik_parsberg.pdf

Parsberg ist keine 1000, sondern 800 Jahre alt: Dies ist bei einem Pressegespräch mit Burgmuseumsleiter Theo Döllinger und Fördervereinsvorsitzendem Helmut Jobst einmal mehr deutlich geworden. Das Museum besitzt seit kurzem eine Urkundenkopie aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv München, die angeblich aus den Jahren 1318 und 1340 stammen sollen. Darin wird bescheinigt, dass „die Parsberger Rechte schon seit 385 Jahren bestehen“.
Archivoberrat Reiprich schreibt an das Burgmuseum: „Die Rechnung, dass Parsberg schon im Jahre 933 bestand, geht von falschen Voraussetzungen aus, nämlich von zwei gefälschten Urkunden, angeblich aus den Jahren 1318 und 1340. Die von 1340 des Kaisers Ludwig des Bayern, die von den damals seit 407 Jahren bestehenden Parsberger Rechten spricht, ist ebenso eine Fälschung, wie die von 1318, die in Amberg liegt.“
Nun bestehen die Parsberger seit Jahren auf der so genannten „Spitzner-Chronik“, die sich auf das Turnierbuch des Georg Rüxner (Rixner) stützt, das dieser 1532 verfasst hat. „Die Spitzner-Chronik ist eine saubere und diffizile Arbeit und soll auch erhalten werden, aber sie ändert nichts an der Tatsache, dass Parsberg 933 noch nicht bestanden hat“, sagt Jobst. Dies habe auch Professor Dr. Alois Schmid in seinen Nachforschungen „Parsberg im Herzogtum der frühen Wittelsbacher“ bescheinigt.
Döllinger fügt hinzu, dass dies bereits der Historiker Manfred Jehle in seinem „Historischen Atlas Bayern“ festgestellt habe. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit der Genehmigung von Bertl Spitzner diese Chronik mit einem Anhang fortzuführen und Unwahrheiten zurechtrücken.“
Der damalige Vortrag von Dr. Schmid (7. Oktober 2005) in Parsberg hat aber weitere Hobby-Forscher auf den Plan gerufen. So hat Alois Dechant die Sache in die Hand genommen und Fragen an die Archive der Städte Magdeburg, Zürich und Nürnberg geschickt – wegen Ritterturnieren, an denen Parsberger genommen haben sollen.
https://archiv.twoday.net/search?q=rüxner
Von einer sauberen Arbeit kann hinsichtlich der Spitzner-Chronik zuallerletzt die Rede sein:
https://www.parsberg.de/fileadmin/downloads/chronik_parsberg.pdf

KlausGraf - am Mittwoch, 24. Juni 2009, 19:16 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/codheidnf9
Zur 1997 von der Uni Heidelberg erworbenen Handschrift der Sammlung Ludwig (danach Malibu) siehe
https://www.handschriftencensus.de/21636
Teilausgabe des überlieferten Textes:
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hofmann1862
Mein NDB-Artikel über den Autor:
https://mdz10.bib-bvb.de/~db/0001/bsb00016334/images/index.html?seite=424
Update:
Auch Heid. Hs. 3599 des gleichen Werks ist online
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heidhs3599
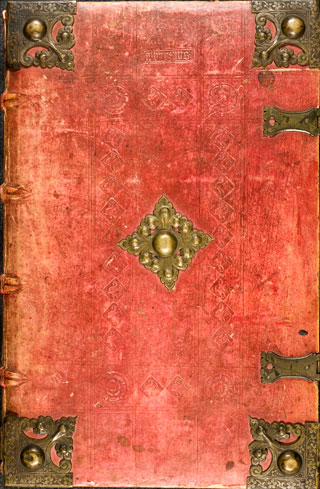
Zur 1997 von der Uni Heidelberg erworbenen Handschrift der Sammlung Ludwig (danach Malibu) siehe
https://www.handschriftencensus.de/21636
Teilausgabe des überlieferten Textes:
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hofmann1862
Mein NDB-Artikel über den Autor:
https://mdz10.bib-bvb.de/~db/0001/bsb00016334/images/index.html?seite=424
Update:
Auch Heid. Hs. 3599 des gleichen Werks ist online
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heidhs3599
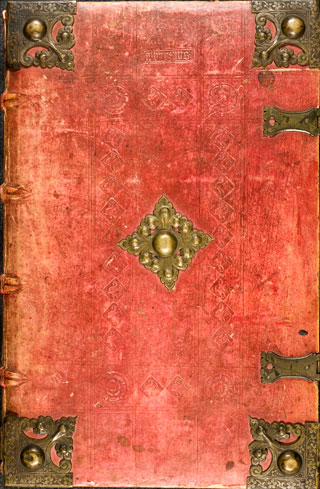
KlausGraf - am Montag, 22. Juni 2009, 17:44 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/313722
https://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege#Christian_Wierstraet

https://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege#Christian_Wierstraet

KlausGraf - am Dienstag, 16. Juni 2009, 18:38 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/315022
Titel Christophori Lehmanni Chronica Der Freyen Reichs-Stadt Speier : Darinnen von Dreyerley fürnemlich gehandelt: Erstlich, vom Ursprung, Uffnehmen, Befreyung, Beschaffenheit des Regiments, Freyheiten, Privilegien, Rechten, Gerechtigkeiten, denckwürdigen Sachen und Geschichten, unterschiedlichen Kriegen und Belägerungen der Stadt Speier ..
Verfasser Lehmann, Christoph
Hrsg. Fuchs, Johann Melchior [Hrsg.]
Erschienen Franckfurth am Mäyn : Oehrling, 1698
Ausgabe Anjetzo ist diese dritte Edition auffs neue mit Fleiß durchsehen, an vielen Orten verbessert und bey nahe den dritten Theil vermehrt / Durch Johann Melchior Fuchs, derzeit Hoch-Gräfl. Wildt- und Rhein-Gräfl. Vormundschafftl. Rath und Amptmann zu Dhaun
Online-Ausg. [Online-Ausg.] Düsseldorf : Universitäts- und Landesbibliothek, 2009
Umfang [14] Bl., 971 S., [42] Bl. ; 4-o [i.e. 2-o]
Update: Ausgabe 1711
https://www.dilibri.de/urn/urn:nbn:de:0128-1-9894
Update: Ausgabe 1662
https://books.google.com/books?id=cus-AAAAcAAJ =
https://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10002937-6
Update: 1662
https://www.dilibri.de/id/467753

Titel Christophori Lehmanni Chronica Der Freyen Reichs-Stadt Speier : Darinnen von Dreyerley fürnemlich gehandelt: Erstlich, vom Ursprung, Uffnehmen, Befreyung, Beschaffenheit des Regiments, Freyheiten, Privilegien, Rechten, Gerechtigkeiten, denckwürdigen Sachen und Geschichten, unterschiedlichen Kriegen und Belägerungen der Stadt Speier ..
Verfasser Lehmann, Christoph
Hrsg. Fuchs, Johann Melchior [Hrsg.]
Erschienen Franckfurth am Mäyn : Oehrling, 1698
Ausgabe Anjetzo ist diese dritte Edition auffs neue mit Fleiß durchsehen, an vielen Orten verbessert und bey nahe den dritten Theil vermehrt / Durch Johann Melchior Fuchs, derzeit Hoch-Gräfl. Wildt- und Rhein-Gräfl. Vormundschafftl. Rath und Amptmann zu Dhaun
Online-Ausg. [Online-Ausg.] Düsseldorf : Universitäts- und Landesbibliothek, 2009
Umfang [14] Bl., 971 S., [42] Bl. ; 4-o [i.e. 2-o]
Update: Ausgabe 1711
https://www.dilibri.de/urn/urn:nbn:de:0128-1-9894
Update: Ausgabe 1662
https://books.google.com/books?id=cus-AAAAcAAJ =
https://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10002937-6
Update: 1662
https://www.dilibri.de/id/467753

KlausGraf - am Dienstag, 16. Juni 2009, 12:32 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die berühmte Handschrift aus dem Kloster Weissenau (Vadiana 321) steht seit Mai online zur Einsicht bereit:
https://www.e-codices.unifr.ch/de/vad/0321/1
Der Text des Chronikteils:
https://la.wikisource.org/wiki/Acta_S._Petri_in_Augia

https://www.e-codices.unifr.ch/de/vad/0321/1
Der Text des Chronikteils:
https://la.wikisource.org/wiki/Acta_S._Petri_in_Augia

KlausGraf - am Mittwoch, 10. Juni 2009, 13:24 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Wittelsbacher-Genealogie von 1501, an deren Ende sich als Drucker ein N. Wurm in Landshut nennt, liegt digitalisiert in München vor:
https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00003570/images/
Die Einleitung Georg Leidingers und sein Faksimile von 1901 ist beim Internetarchiv einsehbar:
https://www.archive.org/details/chronikundstammd00ebrauoft
Den Text behandelte Jean Marie Moeglin, Les Ancetres du Prince, Genève 1985, S. 197-201 sowie kurz Claudia Willebald in der ZBLG 1987:
https://mdz1.bib-bvb.de/cocoon/bayern/zblg/seite/zblg50_0536
https://periodika.digitale-sammlungen.de/zblg/seite/zblg50_0536
Sowohl der Druckort Landshut als auch die Betonung des "Blutstamms" (wie überhaupt das genealogische Thema) passt gut zu Georg Rüxner, der als Jörg Rugen als Diener Herzog Georgs von Bayern-Landshut erscheint. Sein Wappenbuch Innsbruck, Universitätsbibliothek, Hs. 545, enthält eine Chronik der Wittelsbacher, gewidmet seinem „gnadigen herrn“ Herzog Georg von Bayern (gest. 1503). Es wird zu prüfen sein, wie sich diese Chronik zu dem Landshuter Druck verhält.
[Siehe auch: https://archiv.twoday.net/stories/6113291/ ]
Nicht erhalten sind zwei Arbeiten Rüxners zur Wittelsbacher-Genealogie, die in einem Verzeichnis der Genealogien des Pfalzgrafen Johann II. von Simmern, der selbst als Historiograph hervorgetreten ist, erscheinen: “Num. 1. Ein roll auf papir geschrieben, darin Georg Jerusalem kundiger der wappen vnd ehrenknecht in Bairn ausz des Homeri chronica im funfften buch des troianischen geschlechts der pfalzgrafen herkommen - nemlich das sie von dem streitbaren helden Hectore iren vrsprung haben, vnd volgendts das Troilus desselben stambs vor Christi geburt 822 jar regirt hab - deducirt bis auf herzog Albrechten den weisen und mächtigen, seines namens den eilfften, pfalzgrafen bei Rhein, herzogen in obern vnd nidern Bairn, dessen gemahel gewesen ist fraw Königundt, keiser Friderichs dochter [...] Num. 6. Pfalzgraf Ludwigs churfürsten etc. vnd ihrer churfürstl. gn. gemählin fraw Sybilla, herzog Albrechts von Bairn dochter, 64 anherrn mit wappen und der geschlechter nammen, auch ohne jarzal, durch Georg Jerusalem, erkundiger der wappen, zusammen gebracht etc.” Num. 6 ist nach der Hochzeit Ludwigs mit Sibylle 1511 zu datieren. Siehe Ludwig Rockinger, Die Pflege der Geschichte durch die Wittelsbacher, München 1880, S. (18), (20). Das Geheime Hausarchiv konnte die zugrundeliegende Archivalie nicht nachweisen.
Sehr gut zu Rüxners Oeuvre würde auch der Münchner Cgm 699 vom Ende des 15. Jahrhunderts
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0046_a033_jpg.htm
passen. Bedauerlicherweise konnte Prof. Dr. Klaus Arnold eine Schriftgleichheit mit Rugens Autographen nicht bestätigen.
[Digitalisat:
https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00077961/image_1 ]
Eine weitere, möglicherweise auf R. zurückgehende Handschrift befand/befindet sich im Geheimen Hausarchiv in München. Obwohl es kaum vorstellbar ist, dass im Geheimen Hausarchiv nicht aktenkundig gemacht wurde, um welche Handschrift es sich bei dem von Ludwig Rockinger, Ueber ältere Arbeiten zur baierischen und pfälzischen Geschichte im geheimen Haus- und Staatsarchive, in: Abhandlungen der historischen Classe der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 14, 3, München 1879, S. 27-113, hier S. 39-50 ausführlich beschriebenen Sammelband gehandelt hat, hat das Geheime Hausarchiv die erbetene Auskunft nicht gegeben und stattdessen auf die erteilte Benützungsgenehmigung verwiesen. Laut früherem Schreiben vom 2.8.1990 sind aber von der Handschriftensammlung des Geheimen Hausarchivs 1944 fast 60 Prozent verbrannt. Der Inhalt des Bandes würde sachlich und von der Datierung gut zu Rüxner passen.
Rockingers Beschreibung:
https://books.google.com/books?id=OvMAAAAAYAAJ&pg=RA2-PA39 (US-Proxy)
[ https://archive.org/stream/abhandlungender66klasgoog#page/n499/mode/2up ]
Ich hebe hervor S. 43 das Verzeichnis der griechischen Kaiser (siehe Rugens Augsburger Wappenbuch)
S. 44 "blutstamen"
S. 48 Reise nach Konstantinopel 1495
Zu weiteren Inhalten des Handschriftenbandes siehe auch Rockingers Mitteilungen 1880 unter
https://books.google.com/books?id=HPUAAAAAYAAJ&pg=PA164 (US-proxy) Nr. 47a, 54, 58, 59 ( angeblich Aventin!), 60 (desgl.)
[ https://archive.org/stream/abhandlungender50klasgoog#page/n183/mode/2up ]
[Riezler schloss sich hinsichtlich der Zuschreibung an Aventin Rockinger an in Turmair's Werken III, S. 558
https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00016720/image_565
während Spiller die Verfasserschaft - wohl zu Recht - in Abrede stellte
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1034115
Rockingers Zuschreibung auch in einem weiteren Aufsatz 1879:
https://archive.org/stream/sitzungsberichte1879baye#page/n371/mode/2up ]
Leider hat Claudia Willibald in der ZBLG 1987, S. 517 nur Rockinger und Spiller zur Nr. 59 herangezogen:
https://mdz1.bib-bvb.de/cocoon/bayern/zblg/seite/zblg50_0530
https://periodika.digitale-sammlungen.de/zblg/seite/zblg50_0530
Man erfährt also dort leider auch nicht, ob die Handschrift noch erhalten ist und wenn ja welche Signatur sie trägt.
Es könnte sich um Hs. 22 handeln, da Moeglin S. 252 eine Überlieferung der Scheyerner Chronik Bl. 133r-135r (1. V. 16. Jh.) in ihr erwähnt und dies mit der Umfangsangabe (5 S.) und Datierung Rockingers S. 164 Nr. 47 übereinstimmt. Sonst nennt Rockinger zu diesem Text nur die wesentlich spätere Überlieferung des Arrodenius.
Update: Hs. 22 ist im aktuellen Findbuch (angeblich von 2008) des Geheimen Hausarchivs so beschrieben:
Sammelband von Handschriften, 16. Jh.
Das Geheime Hausarchiv erklärte sich nicht bereit, die Identität der von Rockinger beschriebenen Handschrift mit Hs. 22 festzustellen.
Es gibt keine Konkordanz Rockinger-Findbuch und auch kein Handexemplar Rockingers mit den aktuellen Signaturen.
Grundsätzlich wird keine Literatur zu den Handschriften im Findbuch vermerkt. Das sei in Archiven nicht üblich, erklärte die zuständige Archivoberrätin G. am Telefon. Wo kämen wir denn da hin, wenn wir für jede einzelne Urkunde jeweils Literatur angeben würden?
Sapienti sat.
Update: Es handelt sich um Hs. 22! [Autopsie]
[Bereits zur Zeit Spillers (1909) trug die Handschrift die Signatur 22.
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1034096 (Textzeuge "H 22")
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1034869
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1034150 ]
#forschung
https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00003570/images/
Die Einleitung Georg Leidingers und sein Faksimile von 1901 ist beim Internetarchiv einsehbar:
https://www.archive.org/details/chronikundstammd00ebrauoft
Den Text behandelte Jean Marie Moeglin, Les Ancetres du Prince, Genève 1985, S. 197-201 sowie kurz Claudia Willebald in der ZBLG 1987:
https://periodika.digitale-sammlungen.de/zblg/seite/zblg50_0536
Sowohl der Druckort Landshut als auch die Betonung des "Blutstamms" (wie überhaupt das genealogische Thema) passt gut zu Georg Rüxner, der als Jörg Rugen als Diener Herzog Georgs von Bayern-Landshut erscheint. Sein Wappenbuch Innsbruck, Universitätsbibliothek, Hs. 545, enthält eine Chronik der Wittelsbacher, gewidmet seinem „gnadigen herrn“ Herzog Georg von Bayern (gest. 1503). Es wird zu prüfen sein, wie sich diese Chronik zu dem Landshuter Druck verhält.
[Siehe auch: https://archiv.twoday.net/stories/6113291/ ]
Nicht erhalten sind zwei Arbeiten Rüxners zur Wittelsbacher-Genealogie, die in einem Verzeichnis der Genealogien des Pfalzgrafen Johann II. von Simmern, der selbst als Historiograph hervorgetreten ist, erscheinen: “Num. 1. Ein roll auf papir geschrieben, darin Georg Jerusalem kundiger der wappen vnd ehrenknecht in Bairn ausz des Homeri chronica im funfften buch des troianischen geschlechts der pfalzgrafen herkommen - nemlich das sie von dem streitbaren helden Hectore iren vrsprung haben, vnd volgendts das Troilus desselben stambs vor Christi geburt 822 jar regirt hab - deducirt bis auf herzog Albrechten den weisen und mächtigen, seines namens den eilfften, pfalzgrafen bei Rhein, herzogen in obern vnd nidern Bairn, dessen gemahel gewesen ist fraw Königundt, keiser Friderichs dochter [...] Num. 6. Pfalzgraf Ludwigs churfürsten etc. vnd ihrer churfürstl. gn. gemählin fraw Sybilla, herzog Albrechts von Bairn dochter, 64 anherrn mit wappen und der geschlechter nammen, auch ohne jarzal, durch Georg Jerusalem, erkundiger der wappen, zusammen gebracht etc.” Num. 6 ist nach der Hochzeit Ludwigs mit Sibylle 1511 zu datieren. Siehe Ludwig Rockinger, Die Pflege der Geschichte durch die Wittelsbacher, München 1880, S. (18), (20). Das Geheime Hausarchiv konnte die zugrundeliegende Archivalie nicht nachweisen.
Sehr gut zu Rüxners Oeuvre würde auch der Münchner Cgm 699 vom Ende des 15. Jahrhunderts
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0046_a033_jpg.htm
passen. Bedauerlicherweise konnte Prof. Dr. Klaus Arnold eine Schriftgleichheit mit Rugens Autographen nicht bestätigen.
[Digitalisat:
https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00077961/image_1 ]
Eine weitere, möglicherweise auf R. zurückgehende Handschrift befand/befindet sich im Geheimen Hausarchiv in München. Obwohl es kaum vorstellbar ist, dass im Geheimen Hausarchiv nicht aktenkundig gemacht wurde, um welche Handschrift es sich bei dem von Ludwig Rockinger, Ueber ältere Arbeiten zur baierischen und pfälzischen Geschichte im geheimen Haus- und Staatsarchive, in: Abhandlungen der historischen Classe der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 14, 3, München 1879, S. 27-113, hier S. 39-50 ausführlich beschriebenen Sammelband gehandelt hat, hat das Geheime Hausarchiv die erbetene Auskunft nicht gegeben und stattdessen auf die erteilte Benützungsgenehmigung verwiesen. Laut früherem Schreiben vom 2.8.1990 sind aber von der Handschriftensammlung des Geheimen Hausarchivs 1944 fast 60 Prozent verbrannt. Der Inhalt des Bandes würde sachlich und von der Datierung gut zu Rüxner passen.
Rockingers Beschreibung:
https://books.google.com/books?id=OvMAAAAAYAAJ&pg=RA2-PA39 (US-Proxy)
[ https://archive.org/stream/abhandlungender66klasgoog#page/n499/mode/2up ]
Ich hebe hervor S. 43 das Verzeichnis der griechischen Kaiser (siehe Rugens Augsburger Wappenbuch)
S. 44 "blutstamen"
S. 48 Reise nach Konstantinopel 1495
Zu weiteren Inhalten des Handschriftenbandes siehe auch Rockingers Mitteilungen 1880 unter
https://books.google.com/books?id=HPUAAAAAYAAJ&pg=PA164 (US-proxy) Nr. 47a, 54, 58, 59 ( angeblich Aventin!), 60 (desgl.)
[ https://archive.org/stream/abhandlungender50klasgoog#page/n183/mode/2up ]
[Riezler schloss sich hinsichtlich der Zuschreibung an Aventin Rockinger an in Turmair's Werken III, S. 558
https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00016720/image_565
während Spiller die Verfasserschaft - wohl zu Recht - in Abrede stellte
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1034115
Rockingers Zuschreibung auch in einem weiteren Aufsatz 1879:
https://archive.org/stream/sitzungsberichte1879baye#page/n371/mode/2up ]
Leider hat Claudia Willibald in der ZBLG 1987, S. 517 nur Rockinger und Spiller zur Nr. 59 herangezogen:
https://periodika.digitale-sammlungen.de/zblg/seite/zblg50_0530
Man erfährt also dort leider auch nicht, ob die Handschrift noch erhalten ist und wenn ja welche Signatur sie trägt.
Es könnte sich um Hs. 22 handeln, da Moeglin S. 252 eine Überlieferung der Scheyerner Chronik Bl. 133r-135r (1. V. 16. Jh.) in ihr erwähnt und dies mit der Umfangsangabe (5 S.) und Datierung Rockingers S. 164 Nr. 47 übereinstimmt. Sonst nennt Rockinger zu diesem Text nur die wesentlich spätere Überlieferung des Arrodenius.
Update: Hs. 22 ist im aktuellen Findbuch (angeblich von 2008) des Geheimen Hausarchivs so beschrieben:
Sammelband von Handschriften, 16. Jh.
Das Geheime Hausarchiv erklärte sich nicht bereit, die Identität der von Rockinger beschriebenen Handschrift mit Hs. 22 festzustellen.
Es gibt keine Konkordanz Rockinger-Findbuch und auch kein Handexemplar Rockingers mit den aktuellen Signaturen.
Grundsätzlich wird keine Literatur zu den Handschriften im Findbuch vermerkt. Das sei in Archiven nicht üblich, erklärte die zuständige Archivoberrätin G. am Telefon. Wo kämen wir denn da hin, wenn wir für jede einzelne Urkunde jeweils Literatur angeben würden?
Sapienti sat.
Update: Es handelt sich um Hs. 22! [Autopsie]
[Bereits zur Zeit Spillers (1909) trug die Handschrift die Signatur 22.
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1034096 (Textzeuge "H 22")
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1034869
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1034150 ]
#forschung
KlausGraf - am Montag, 8. Juni 2009, 00:49 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2045427
Dank Bodenradar wissen Archäologen nun exakt, wo die Burg Hohenstaufen und die Kirche des Schopflenbergs bei Bezgenriet einst standen. Und sie haben noch mehr entdeckt. Die Stadt Göppingen ließ sich den Einsatz eines Expertenteams rund 5000 Euro kosten. [...]
Dass auf dem Hohenstaufen einst eine Burg stand, ist nicht neu. 1525 brannten sie aufständische Bauern nieder. Heute sind auf dem Burgplateau nur noch Reste der Mauer übrig, die in den 1930er Jahren ausgegraben wurden. "Wir vermuten, dass 99 Prozent der Baufunde im Boden versteckt sind", sagt Reinhard Rademacher. Er ist der Archäologe des Landkreises. Aufzeichnungen belegen zudem Sprengarbeiten in der Burgruine und den Abtransport der Mauersteine. Dies wurde auch durch die Radaraufzeichungen bestätigt, sagt Rademacher. Es hat noch mehr entdeckt: im Südwesten der Burg einen Bubenturm - im Osten stand vermutlich ein zweiter -, eine Zisterne, ein für das Mittelalter typischer Graben, der die Haupt- von der Vorburg trennte, und einen Großteil der Umfassungsmauer.
Den Fund der 40 Gebeine vor sechs Jahren, deren Alter bis ins achte oder neunte Jahrhundert zurückreicht, können die Archäologen nun ebenfalls erklären. In der Nähe des späteren Burgfrieds habe sich eine Pfarrkirche befunden, sagt Kreisarchivar Walter Ziegler. Weil man dort bestatten durfte, sei dort ein Friedhof gewesen.
Auch der Schopflenberg hatte bis 1554 ein Gotteshaus. Immer wieder sind Landwirte beim Pflügen der Äcker auf Steine gestoßen. Die Archäologen konnten die Position der 20 Meter langen Kirche mit einem Turm und einer runden Apsis exakt orten. Dabei erlebten sie zwei Überraschungen. "In einer tieferen Schicht haben wir einen zweiten Grundriss gefunden", sagt Karl-Heinz Rueß. Er ist der Göppinger Stadtarchivar. Die ältere Kirche wurde abgerissen und durch einen größeren Neubau ersetzt. "Zudem fanden wir nahe der Kirche eine Burganlage." In der Mitte der 30 mal 30 Meter großen Grabenanlage stand ein Turm. Eine Palisade sicherte ihn. "Er war ein Wehr- und Wohnturm der Adligen."
Die Ausgrabung würde Unsummen kosten
Trotz der Erkenntnisse bleiben Fragen offen - etwa das Alter der Kirche am Schopflenberg. Um dies zu bestimmten, müssten die Funde freigelegt werden. Genau das ist aber nicht geplant. Die Ausgrabung, Auswertung und Konservierung der Bodenschätze würde Jahre dauern und Unsummen kosten. "Uns geht es mehr um den Schutz der Denkmäler", sagt Rademacher - das Burgplateau des Hohenstaufen ist denkmalgeschützt, der Schopflenberg wird landwirtschaftlich genutzt. Das sieht Bürgermeister Jürgen Lämmle genauso. Überdies bezahlte die Stadt für den Einsatz der geophysikalischen Prospektion 5000 Euro. [...]

Dank Bodenradar wissen Archäologen nun exakt, wo die Burg Hohenstaufen und die Kirche des Schopflenbergs bei Bezgenriet einst standen. Und sie haben noch mehr entdeckt. Die Stadt Göppingen ließ sich den Einsatz eines Expertenteams rund 5000 Euro kosten. [...]
Dass auf dem Hohenstaufen einst eine Burg stand, ist nicht neu. 1525 brannten sie aufständische Bauern nieder. Heute sind auf dem Burgplateau nur noch Reste der Mauer übrig, die in den 1930er Jahren ausgegraben wurden. "Wir vermuten, dass 99 Prozent der Baufunde im Boden versteckt sind", sagt Reinhard Rademacher. Er ist der Archäologe des Landkreises. Aufzeichnungen belegen zudem Sprengarbeiten in der Burgruine und den Abtransport der Mauersteine. Dies wurde auch durch die Radaraufzeichungen bestätigt, sagt Rademacher. Es hat noch mehr entdeckt: im Südwesten der Burg einen Bubenturm - im Osten stand vermutlich ein zweiter -, eine Zisterne, ein für das Mittelalter typischer Graben, der die Haupt- von der Vorburg trennte, und einen Großteil der Umfassungsmauer.
Den Fund der 40 Gebeine vor sechs Jahren, deren Alter bis ins achte oder neunte Jahrhundert zurückreicht, können die Archäologen nun ebenfalls erklären. In der Nähe des späteren Burgfrieds habe sich eine Pfarrkirche befunden, sagt Kreisarchivar Walter Ziegler. Weil man dort bestatten durfte, sei dort ein Friedhof gewesen.
Auch der Schopflenberg hatte bis 1554 ein Gotteshaus. Immer wieder sind Landwirte beim Pflügen der Äcker auf Steine gestoßen. Die Archäologen konnten die Position der 20 Meter langen Kirche mit einem Turm und einer runden Apsis exakt orten. Dabei erlebten sie zwei Überraschungen. "In einer tieferen Schicht haben wir einen zweiten Grundriss gefunden", sagt Karl-Heinz Rueß. Er ist der Göppinger Stadtarchivar. Die ältere Kirche wurde abgerissen und durch einen größeren Neubau ersetzt. "Zudem fanden wir nahe der Kirche eine Burganlage." In der Mitte der 30 mal 30 Meter großen Grabenanlage stand ein Turm. Eine Palisade sicherte ihn. "Er war ein Wehr- und Wohnturm der Adligen."
Die Ausgrabung würde Unsummen kosten
Trotz der Erkenntnisse bleiben Fragen offen - etwa das Alter der Kirche am Schopflenberg. Um dies zu bestimmten, müssten die Funde freigelegt werden. Genau das ist aber nicht geplant. Die Ausgrabung, Auswertung und Konservierung der Bodenschätze würde Jahre dauern und Unsummen kosten. "Uns geht es mehr um den Schutz der Denkmäler", sagt Rademacher - das Burgplateau des Hohenstaufen ist denkmalgeschützt, der Schopflenberg wird landwirtschaftlich genutzt. Das sieht Bürgermeister Jürgen Lämmle genauso. Überdies bezahlte die Stadt für den Einsatz der geophysikalischen Prospektion 5000 Euro. [...]

KlausGraf - am Sonntag, 7. Juni 2009, 14:42 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Immer wieder muss man den Verächtern der Wikipedia, die mit maßloser Arroganz über sie herziehen, unter die Nase reiben, dass auch die renommierten Nachschlagewerke miese und schlechte Artikel enthalten.
Beispiel:
Jakob Mennel in der Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Mennel
Jakob Mennel im HLS (2008)
https://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D21568.php
Nun mag man der Wikipedia vorhalten, dass sie
K.-H. BURMEISTER, Seine Karriere begann auf dem Freiburger Reichstag. Der Jurist und Historiker Dr. Jakob Mennel (1460-1526), in: H. SCHADEK, Hg., Der Kaiser in seiner Stadt. Maximilian I. und der Reichstag zu Freiburg 1498, 1998, 94-113
nicht hatte. Aber unverzeihlich ist, dass die Zürcher Historikerin den Artikel schlampig heruntergeschrieben hat, ohne die maßgebliche neuere Literatur zu bibliographieren.
2007 erschien übrigens in Heft 147 von LiLi:
Beate Kellner und Linda Webers
Genealogische Entwürfe am Hof Kaiser Maximilians I. (am Beispiel von Jakob Mennels Fürstlicher Chronik)

Beispiel:
Jakob Mennel in der Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Mennel
Jakob Mennel im HLS (2008)
https://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D21568.php
Nun mag man der Wikipedia vorhalten, dass sie
K.-H. BURMEISTER, Seine Karriere begann auf dem Freiburger Reichstag. Der Jurist und Historiker Dr. Jakob Mennel (1460-1526), in: H. SCHADEK, Hg., Der Kaiser in seiner Stadt. Maximilian I. und der Reichstag zu Freiburg 1498, 1998, 94-113
nicht hatte. Aber unverzeihlich ist, dass die Zürcher Historikerin den Artikel schlampig heruntergeschrieben hat, ohne die maßgebliche neuere Literatur zu bibliographieren.
2007 erschien übrigens in Heft 147 von LiLi:
Beate Kellner und Linda Webers
Genealogische Entwürfe am Hof Kaiser Maximilians I. (am Beispiel von Jakob Mennels Fürstlicher Chronik)

KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 03:30 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen