Landesgeschichte
Die 1947 erstellte Dokumentation berichtet über die Tätigkeit des 1946 wieder begründeten AWO-Landesverbandes Bayern und die soziale Lage in Bayern in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Das handschriftlich erstellte und bebilderte Album ist zweisprachig in deutscher und englischer Sprache. Adressat waren wohl amerikanische Hilfsorganisationen.
https://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/soziale-lage-1947

https://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/soziale-lage-1947

KlausGraf - am Sonntag, 16. Mai 2010, 15:53 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Freitag, 14. Mai 2010, 22:09 - Rubrik: Landesgeschichte
https://tinyurl.com/29rr7y7
Darunter auch die Druckfassung der Dissertation zu den Vorarlberger Hexenverfolgungen 1992.
Darunter auch die Druckfassung der Dissertation zu den Vorarlberger Hexenverfolgungen 1992.
KlausGraf - am Freitag, 14. Mai 2010, 04:48 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Stadt Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis steht vom 11. Juni bis zum 10. Oktober 2010 ganz im Zeichen seiner [sic!] Gold- und Silberschmiedetradition, die bis ins Jahr 1372 nach weisbar ist. Noch heute gibt es in der Stauferstadt mehr als 50 Gold- und Silber schmiede, Schmuckgestalter und über 20 Manufakturen und Fabriken, die Schmuck herstellen.
Die Ausstellung „Aufbruch in die Moderne. Silber aus Schwäbisch Gmünd“ im Museum im Prediger führt dem Besucher mit rund 400 Objekten aus Gmünder Silberwarenfabriken diese lange Tradition vor Augen.
https://damals.brauch-hilfe.de/de/4/news.html?aid=189759&action=showDetails
Urkunde von 1372: "Hannsen dem goldsmit"
https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Sebald_Schreyer_und_die_Sebalduskapelle_zu_Schwaebisch-Gmuend.pdf/3
Update:
Siehe auch (nestbeschmutzend) Klaus Graf: Die Gmünder Goldschmiedstradition, in: einhorn-Jahrbuch Schwäbisch Gmünd 1984, S. 156-17. Online (Scan mit OCR):
https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7514/
Der Aufsatz, "nicht ohne Bedenken zur Veröffentlichung angenommen", wurde von der Redaktion mit einer Vorbemerkung "Gmünder Goldschmiedstradition Pro und Contra" (S. 154f.) und einer kritischen Stellungnahme des Verlegers Eduard Dietenberger, Warum ich von der Gmünder Goldschmiedtradition überzeugt bin (S. 172-181) eingerahmt.
Als Goldschmiedstradition wird die Überzeugung definiert, "daß es seit alter Zeit (Stauferzeit, Parlerzeit, Mittelalter) in Schwäbisch Gmünd stets zahlreiche tüchtige und angesehene Gold- und Silberschmiede gegeben hat, die ihre künstlerisch hochwertigen Produkte in aller Welt absetzten" (S. 156). Der erste Abschnitt "Gmünder Goldschmiede vor dem Dreißigjährigen Krieg" versucht die Gegenthese zu begründen: "Vor dem Dreißigjährigen Krieg unterschieden sich Anzahl und Produktion der Gmünder Goldschmiede in nichts von dem, was in anderen Städten vergleichbarer Größe und Bedeutung üblich war" (S. 157). Als zweite These wurde formuliert: "Von etwa 1650 bis zum Beginn der fabrikmäßigen Fertigung um 1830 wurde von den Gmünder Silberarbeitern der meiste Umsatz nicht mit hochwertigen Silberwaren, sondern mit von Hausierern und Händlern massenhaft vertriebenen Kleinsilberwaren gemacht, deren Ruf aufgrund des mangelnden Feingehalts sprichwörtlich schlecht war" (S. 159). In diesen ersten beiden Abschnitten werden ausführlich zeitgenössische, insbesondere chronikalische Quellenzeugnisse über die Gmünder Hauptgewerbe seit Ende des 15. Jahrhunderts zitiert. Der nächste Teil "Der Gmünd'schen Künstler Ehre" (Zitat aus Justinus Kerners "Geiger von Gmünd") stellt die Rückprojektion des Gmünder Hauptgewerbes in die Stauferzeit in literarischen Werken seit etwa 1816 fest. "In den Jahren der Krise wurde die Gmünder Goldschmiedstradition aus dem Geist der Romantik geboren" (S. 162). Die Überschriften der abschließenden Abschnitte lauten: "Die Wahrheit der Werbeschriften und Stadtprospekte" und "Das geträumte Glück einer glanzvollen Tradition".
 Gmünder Fabrikantengattin Anna Kott mit Schmuck
Gmünder Fabrikantengattin Anna Kott mit Schmuck
Die Ausstellung „Aufbruch in die Moderne. Silber aus Schwäbisch Gmünd“ im Museum im Prediger führt dem Besucher mit rund 400 Objekten aus Gmünder Silberwarenfabriken diese lange Tradition vor Augen.
https://damals.brauch-hilfe.de/de/4/news.html?aid=189759&action=showDetails
Urkunde von 1372: "Hannsen dem goldsmit"
https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Sebald_Schreyer_und_die_Sebalduskapelle_zu_Schwaebisch-Gmuend.pdf/3
Update:
Siehe auch (nestbeschmutzend) Klaus Graf: Die Gmünder Goldschmiedstradition, in: einhorn-Jahrbuch Schwäbisch Gmünd 1984, S. 156-17. Online (Scan mit OCR):
https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7514/
Der Aufsatz, "nicht ohne Bedenken zur Veröffentlichung angenommen", wurde von der Redaktion mit einer Vorbemerkung "Gmünder Goldschmiedstradition Pro und Contra" (S. 154f.) und einer kritischen Stellungnahme des Verlegers Eduard Dietenberger, Warum ich von der Gmünder Goldschmiedtradition überzeugt bin (S. 172-181) eingerahmt.
Als Goldschmiedstradition wird die Überzeugung definiert, "daß es seit alter Zeit (Stauferzeit, Parlerzeit, Mittelalter) in Schwäbisch Gmünd stets zahlreiche tüchtige und angesehene Gold- und Silberschmiede gegeben hat, die ihre künstlerisch hochwertigen Produkte in aller Welt absetzten" (S. 156). Der erste Abschnitt "Gmünder Goldschmiede vor dem Dreißigjährigen Krieg" versucht die Gegenthese zu begründen: "Vor dem Dreißigjährigen Krieg unterschieden sich Anzahl und Produktion der Gmünder Goldschmiede in nichts von dem, was in anderen Städten vergleichbarer Größe und Bedeutung üblich war" (S. 157). Als zweite These wurde formuliert: "Von etwa 1650 bis zum Beginn der fabrikmäßigen Fertigung um 1830 wurde von den Gmünder Silberarbeitern der meiste Umsatz nicht mit hochwertigen Silberwaren, sondern mit von Hausierern und Händlern massenhaft vertriebenen Kleinsilberwaren gemacht, deren Ruf aufgrund des mangelnden Feingehalts sprichwörtlich schlecht war" (S. 159). In diesen ersten beiden Abschnitten werden ausführlich zeitgenössische, insbesondere chronikalische Quellenzeugnisse über die Gmünder Hauptgewerbe seit Ende des 15. Jahrhunderts zitiert. Der nächste Teil "Der Gmünd'schen Künstler Ehre" (Zitat aus Justinus Kerners "Geiger von Gmünd") stellt die Rückprojektion des Gmünder Hauptgewerbes in die Stauferzeit in literarischen Werken seit etwa 1816 fest. "In den Jahren der Krise wurde die Gmünder Goldschmiedstradition aus dem Geist der Romantik geboren" (S. 162). Die Überschriften der abschließenden Abschnitte lauten: "Die Wahrheit der Werbeschriften und Stadtprospekte" und "Das geträumte Glück einer glanzvollen Tradition".
 Gmünder Fabrikantengattin Anna Kott mit Schmuck
Gmünder Fabrikantengattin Anna Kott mit SchmuckKlausGraf - am Freitag, 14. Mai 2010, 02:52 - Rubrik: Landesgeschichte
Andrea Beyer hat auf meine Bitte hin einen kleinen Fundbericht über die Identifzierung des württembergischen Kinder- und Jugendbuchautors "J. B. Rothacker" verfasst. KG
Wer war J. B. Rothacker?
Von Andrea Beyer
Der Name J. B. Rothacker taucht immer wieder im Zusammenhang mit Sagensammlungen auf. Aber wer war das eigentlich?
Erster Blick ins World Biographical Information System (WBIS): 10
Treffer für Rothacker, aber keiner der in Frage kam. Nächster Versuch die Personennamendatei (PND) [1], auch da nur unter vorgenannter Namensform. Weitere Suchen nach einem Hinweis in Bibliothekskatalogen wie HeBIS [2] oder dem Karlsruher Virtuellen Katalog (KVK) [3] blieben ergebnislos. Letzte Hoffnung eine intensive Recherche bei Google Books.
Erste grobe Suche ergab 2 Bücher im Volltext: "Süddeutschlands Sagen", 2. Auflage, Stuttgart: Fischhaber, 1859 und "Auserlesene Mährchen". Reutlingen: Heerbrandt, 1839. Schaut man bei der Sagensammlung unter "Andere Ausgaben", lässt sich die Erstausgabe Reutlingen: Enßlin und Laiblin von 1837 finden [4]. Bei genaueren Hinsehen enthält diese Ausgabe zwei Titelblätter, eines mit der Verfasserangabe J. B. Rothacker, das andere mit J. B. R. Es liegt also der Verdacht nahe, dass es weitere Schriften unter diesem Akronym geben könnte. Und in der Tat kam ein weiteres Exemplar der Erstausgabe der Süddeutschen Sagen [5] zum Vorschein.
Die Suche lässt sich mit vielerlei Buchstabenkombinationen erweitern, wie z.B. "J+B+R" "Johann Rothacker" oder "J+B+Rothacker", und tatsächlich gab es einen Eintrag, der hoffen ließ. Im Königlich-Württembergisches Hof- und Staats-Handbuch auf die Jahre 1809 und 1810 steht unter Amtsstadt Herrenberg folgender Eintrag: Collaborator: Hr. Joh. Burkhard Rothacker [6].
Einem Hinweis auf das Deutsche Literaturarchiv Marbach nachgehend, welches einen Brief Rothackers an den Cotta-Verlag besitzt, stellte sich heraus, dass der Gesuchte mit dem Kollaborator identisch ist [7].
Durch weitere Nachfragen, so beim Landeskirchlichen Archiv Stuttgart und den Stadtarchiven Tübingen und Herrenberg, konnte folgender Lebenslauf ermittelt werden.
Johann Burkhardt Rothacker wurde am 5. August 1779 als Sohn eines Schusters in Tübingen geboren [8].
Bis 1797 erhielt er seine Lehrerausbildung an der Tübinger Schola
Anatolica [9]. Bereits im Jahr 1796 bewarb er sich mit einem
Empfehlungsschreiben des Tübinger Professors Dr. Ludwig Josef Uhland an der deutschen Knabenschule als Provisor, bekam diese Stelle aber nicht [10].
1798 bekam Rothacker eine Anstellung als 2. Provisor an der Tübinger Mädchenschule [9].
Ab 1809 [11] unterrichtete er als Kollaborator an der Lateinschule in
Herrenberg, wo er wegen "mäßigen Erfolg[s]" am 6. April 1823 seinen Abschied erhielt [12] und im gleichen Jahr wieder nach Tübingen zog [13].
Rothacker heiratete 1810 die acht Jahre jüngere Rosina Gottliebin,
geborene Kronecker aus Tübingen (Tochter eines Bortenwirkers), die 1812 starb. Zweite Ehefrau wurde 1813 Friedericke Christiane, geborene Trautmann aus Großbottwar (* 1779). Das Paar hatte fünf Kinder, von denen vier kurz nach der Geburt verstarben[8] [13]. Laut Rothackers eigenen Angaben erlag seine Ehefrau 1834 der Ruhr [7].
Johann Burkhardt Rothacker starb am 5. Dezember 1851 in Tübingen [8].
Johann Burkhardt Rothacker, der als Lehrer in Tübingen und Herrenberg wirkte, hatte es im Leben nicht leicht. Wohlstand [14] war ihm mit seinem kargen Einkommen und der Herausgabe mehrerer Schriften nicht vergönnt, was sich unter anderem seinem Bettelbrief an den Verlag Cotta in Tübingen entnehmen lässt [7].
Der Pädagoge schrieb Sagen- und Märchensammlungen, sowie Erzählungen, Sprüche und Belehrungen für die Jugend. Eine - bisher nicht vorhandene - Bibliographie seiner Werke findet sich in Wikisource [15].
[1] https://d-nb.info/gnd/100260837 . Für Unterstützung danke ich Klaus Graf.
[2] https://www.portal.hebis.de/servlet/Top/searchadvanced
[3] https://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
[4] https://books.google.com/books?id=srJZAAAAMAAJ
[5] https://books.google.com/books?id=jz8WAAAAYAAJ
[6] https://books.google.com/books?id=CmwAAAAAcAAJ&pg=RA1-PA348
[7] https://de.wikisource.org/wiki/Brief_an_Cotta_%28Rothacker%29
[8] Familienregister Tübingen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Familienregister_Tuebingen_Rothacker.jpg
[9] Wolfram Hauer: Lokale Schulentwicklung und städtische Lebenswelt. Das Schulwesen in Tübingen von seinen Anfängen im Spätmittelalter bis 1806, 2003, S. 408
https://books.google.com/books?id=tHNZqPs2630C&pg=PA408 . Wenn er im Tübinger Bürgerbuch als Privatlehrer erscheint, passt das zu der Aussage im Brief an den 1796 geborenen Johann Georg IV. Freiherr Cotta von Cottendorf (siehe Anmerkung 7), er sei dessen erster ABC-Lehrer gewesen.
[10] Hauer: ebenda, S. 225
https://books.google.com/books?id=tHNZqPs2630C&pg=PA225. Das
Stadtarchiv Tübingen teilte mit: Die Wiederaufnahme ins Bürgerrecht erfolgte am 30. Juli 1823. Als Berufsbezeichnung ist Privatlehrer angegeben. Nach seinem Tode wurde keine Inventur vorgenommen. Das Findbuch zum Bestand A80 "Inventuren und Teilungen" verweist auf eine Armutsurkunde vom 19. Januar 1852 (Stadtarchiv Tübingen A80/189, Bl. 595).
[11] In den Personalakten der Lehrer abweichende Beschäftigungszeit für Herrenberg: 1808-1826, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, E 203 I Bü 1363 https://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=2-1831972
[12] Herrenberg und seine Lateinschule. Hrsg. von Walter Gerblich [1962], S. 115. 1824 heißt es: "Bekanntlich haben wir nach langem Kampf unsere Schule von Rothacker befreit" (ebd.).
[13] Familienregister Herrenberg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Familienregister_Herrenberg_Rothacker.jpg.
Nach den Inventuren und Teilungen im Stadtarchiv Herrenberg war der Vater von Rosina: Adam Friedrich Kronecker, Bortenwirker (Inv.
2.12.1813).
[14] 1814 war die Hälfte seiner Besoldung mit Arrest belegt. Siehe:
Herrenberg und seine Lateinschule. Hrsg. von Walter Gerblich [1962], S. 115
[15] https://de.wikisource.org/wiki/Johann_Burkhardt_Rothacker
#forschung
Wer war J. B. Rothacker?
Von Andrea Beyer
Der Name J. B. Rothacker taucht immer wieder im Zusammenhang mit Sagensammlungen auf. Aber wer war das eigentlich?
Erster Blick ins World Biographical Information System (WBIS): 10
Treffer für Rothacker, aber keiner der in Frage kam. Nächster Versuch die Personennamendatei (PND) [1], auch da nur unter vorgenannter Namensform. Weitere Suchen nach einem Hinweis in Bibliothekskatalogen wie HeBIS [2] oder dem Karlsruher Virtuellen Katalog (KVK) [3] blieben ergebnislos. Letzte Hoffnung eine intensive Recherche bei Google Books.
Erste grobe Suche ergab 2 Bücher im Volltext: "Süddeutschlands Sagen", 2. Auflage, Stuttgart: Fischhaber, 1859 und "Auserlesene Mährchen". Reutlingen: Heerbrandt, 1839. Schaut man bei der Sagensammlung unter "Andere Ausgaben", lässt sich die Erstausgabe Reutlingen: Enßlin und Laiblin von 1837 finden [4]. Bei genaueren Hinsehen enthält diese Ausgabe zwei Titelblätter, eines mit der Verfasserangabe J. B. Rothacker, das andere mit J. B. R. Es liegt also der Verdacht nahe, dass es weitere Schriften unter diesem Akronym geben könnte. Und in der Tat kam ein weiteres Exemplar der Erstausgabe der Süddeutschen Sagen [5] zum Vorschein.
Die Suche lässt sich mit vielerlei Buchstabenkombinationen erweitern, wie z.B. "J+B+R" "Johann Rothacker" oder "J+B+Rothacker", und tatsächlich gab es einen Eintrag, der hoffen ließ. Im Königlich-Württembergisches Hof- und Staats-Handbuch auf die Jahre 1809 und 1810 steht unter Amtsstadt Herrenberg folgender Eintrag: Collaborator: Hr. Joh. Burkhard Rothacker [6].
Einem Hinweis auf das Deutsche Literaturarchiv Marbach nachgehend, welches einen Brief Rothackers an den Cotta-Verlag besitzt, stellte sich heraus, dass der Gesuchte mit dem Kollaborator identisch ist [7].
Durch weitere Nachfragen, so beim Landeskirchlichen Archiv Stuttgart und den Stadtarchiven Tübingen und Herrenberg, konnte folgender Lebenslauf ermittelt werden.
Johann Burkhardt Rothacker wurde am 5. August 1779 als Sohn eines Schusters in Tübingen geboren [8].
Bis 1797 erhielt er seine Lehrerausbildung an der Tübinger Schola
Anatolica [9]. Bereits im Jahr 1796 bewarb er sich mit einem
Empfehlungsschreiben des Tübinger Professors Dr. Ludwig Josef Uhland an der deutschen Knabenschule als Provisor, bekam diese Stelle aber nicht [10].
1798 bekam Rothacker eine Anstellung als 2. Provisor an der Tübinger Mädchenschule [9].
Ab 1809 [11] unterrichtete er als Kollaborator an der Lateinschule in
Herrenberg, wo er wegen "mäßigen Erfolg[s]" am 6. April 1823 seinen Abschied erhielt [12] und im gleichen Jahr wieder nach Tübingen zog [13].
Rothacker heiratete 1810 die acht Jahre jüngere Rosina Gottliebin,
geborene Kronecker aus Tübingen (Tochter eines Bortenwirkers), die 1812 starb. Zweite Ehefrau wurde 1813 Friedericke Christiane, geborene Trautmann aus Großbottwar (* 1779). Das Paar hatte fünf Kinder, von denen vier kurz nach der Geburt verstarben[8] [13]. Laut Rothackers eigenen Angaben erlag seine Ehefrau 1834 der Ruhr [7].
Johann Burkhardt Rothacker starb am 5. Dezember 1851 in Tübingen [8].
Johann Burkhardt Rothacker, der als Lehrer in Tübingen und Herrenberg wirkte, hatte es im Leben nicht leicht. Wohlstand [14] war ihm mit seinem kargen Einkommen und der Herausgabe mehrerer Schriften nicht vergönnt, was sich unter anderem seinem Bettelbrief an den Verlag Cotta in Tübingen entnehmen lässt [7].
Der Pädagoge schrieb Sagen- und Märchensammlungen, sowie Erzählungen, Sprüche und Belehrungen für die Jugend. Eine - bisher nicht vorhandene - Bibliographie seiner Werke findet sich in Wikisource [15].
[1] https://d-nb.info/gnd/100260837 . Für Unterstützung danke ich Klaus Graf.
[2] https://www.portal.hebis.de/servlet/Top/searchadvanced
[3] https://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
[4] https://books.google.com/books?id=srJZAAAAMAAJ
[5] https://books.google.com/books?id=jz8WAAAAYAAJ
[6] https://books.google.com/books?id=CmwAAAAAcAAJ&pg=RA1-PA348
[7] https://de.wikisource.org/wiki/Brief_an_Cotta_%28Rothacker%29
[8] Familienregister Tübingen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Familienregister_Tuebingen_Rothacker.jpg
[9] Wolfram Hauer: Lokale Schulentwicklung und städtische Lebenswelt. Das Schulwesen in Tübingen von seinen Anfängen im Spätmittelalter bis 1806, 2003, S. 408
https://books.google.com/books?id=tHNZqPs2630C&pg=PA408 . Wenn er im Tübinger Bürgerbuch als Privatlehrer erscheint, passt das zu der Aussage im Brief an den 1796 geborenen Johann Georg IV. Freiherr Cotta von Cottendorf (siehe Anmerkung 7), er sei dessen erster ABC-Lehrer gewesen.
[10] Hauer: ebenda, S. 225
https://books.google.com/books?id=tHNZqPs2630C&pg=PA225. Das
Stadtarchiv Tübingen teilte mit: Die Wiederaufnahme ins Bürgerrecht erfolgte am 30. Juli 1823. Als Berufsbezeichnung ist Privatlehrer angegeben. Nach seinem Tode wurde keine Inventur vorgenommen. Das Findbuch zum Bestand A80 "Inventuren und Teilungen" verweist auf eine Armutsurkunde vom 19. Januar 1852 (Stadtarchiv Tübingen A80/189, Bl. 595).
[11] In den Personalakten der Lehrer abweichende Beschäftigungszeit für Herrenberg: 1808-1826, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, E 203 I Bü 1363 https://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=2-1831972
[12] Herrenberg und seine Lateinschule. Hrsg. von Walter Gerblich [1962], S. 115. 1824 heißt es: "Bekanntlich haben wir nach langem Kampf unsere Schule von Rothacker befreit" (ebd.).
[13] Familienregister Herrenberg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Familienregister_Herrenberg_Rothacker.jpg.
Nach den Inventuren und Teilungen im Stadtarchiv Herrenberg war der Vater von Rosina: Adam Friedrich Kronecker, Bortenwirker (Inv.
2.12.1813).
[14] 1814 war die Hälfte seiner Besoldung mit Arrest belegt. Siehe:
Herrenberg und seine Lateinschule. Hrsg. von Walter Gerblich [1962], S. 115
[15] https://de.wikisource.org/wiki/Johann_Burkhardt_Rothacker
#forschung
KlausGraf - am Dienstag, 11. Mai 2010, 01:53 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://opus.bsz-bw.de/swop/volltexte/2010/822/pdf/zkdial64.pdf
Für das Bundesland Baden-Württemberg ist derzeit das landeskundliche Informationsportal LEO (= Landeskunde entdecken, erforschen, erleben online), im Aufbau, an dem sich verschiedene Kooperationspartner beteiligen: Landesarchiv Baden-Württemberg, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Haus der Geschichte, Badische und Württembergische Landesbibliothek, Kommission für geschichtliche Landeskunde Baden-Württemberg, Landesmedienzentrum, Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung, Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege, Statistisches Landesamt. Diese Einrichtungen bringen jeweils verschiedene Module in die Kooperation ein, die für das Portal wichtig sind (SWB-Datenbank, Historische Statistikdaten, Findmittel für Archivbestände, Historisches Ortslexikon Baden-Württemberg, Landesbibliographie, Baden-Württembergisches Online-Archiv, historische und aktuelle Abbildungen, geographische Basisdaten usw). Eine ausführliche Beschreibung von LEO hat das Landesarchiv Baden-Württemberg ins Netz gestellt. Auf der Website der AG Regionalportale am LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte in Münster ist eine Übersicht der bereits betriebenen oder im Aufbau befindlichen Internet-Portale zur Landes- und Regionalgeschichte sowie Landeskunde abrufbar.
In diesem Zusammenhang ist eine Pressemitteilung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg vom 05.05.2010 von Interesse, die ab dem kommenden Jahr die Förderung der Digitalisierung von Archiv- und Bibliotheksgut mit Landesbezug ankündigt. Für 2011 stehen 250.000 Euro zur Verfügung, das Programm soll in den Folgejahren fortgesetzt werden. Staatliche und nichtstaatliche Archive und Bibliotheken können Anträge stellen.
Für das Bundesland Baden-Württemberg ist derzeit das landeskundliche Informationsportal LEO (= Landeskunde entdecken, erforschen, erleben online), im Aufbau, an dem sich verschiedene Kooperationspartner beteiligen: Landesarchiv Baden-Württemberg, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Haus der Geschichte, Badische und Württembergische Landesbibliothek, Kommission für geschichtliche Landeskunde Baden-Württemberg, Landesmedienzentrum, Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung, Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege, Statistisches Landesamt. Diese Einrichtungen bringen jeweils verschiedene Module in die Kooperation ein, die für das Portal wichtig sind (SWB-Datenbank, Historische Statistikdaten, Findmittel für Archivbestände, Historisches Ortslexikon Baden-Württemberg, Landesbibliographie, Baden-Württembergisches Online-Archiv, historische und aktuelle Abbildungen, geographische Basisdaten usw). Eine ausführliche Beschreibung von LEO hat das Landesarchiv Baden-Württemberg ins Netz gestellt. Auf der Website der AG Regionalportale am LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte in Münster ist eine Übersicht der bereits betriebenen oder im Aufbau befindlichen Internet-Portale zur Landes- und Regionalgeschichte sowie Landeskunde abrufbar.
In diesem Zusammenhang ist eine Pressemitteilung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg vom 05.05.2010 von Interesse, die ab dem kommenden Jahr die Förderung der Digitalisierung von Archiv- und Bibliotheksgut mit Landesbezug ankündigt. Für 2011 stehen 250.000 Euro zur Verfügung, das Programm soll in den Folgejahren fortgesetzt werden. Staatliche und nichtstaatliche Archive und Bibliotheken können Anträge stellen.
KlausGraf - am Freitag, 7. Mai 2010, 18:34 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://de.wikisource.org/wiki/Hans_Böhm
Bilder:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hans_B%C3%B6hm
Auf den eher schlechten Wikipedia-Artikel verlinke ich bewusst nicht.
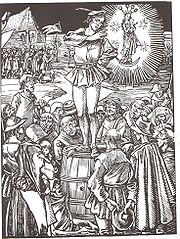 Grafik von Rudolf Schiestl
Grafik von Rudolf Schiestl
Bilder:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hans_B%C3%B6hm
Auf den eher schlechten Wikipedia-Artikel verlinke ich bewusst nicht.
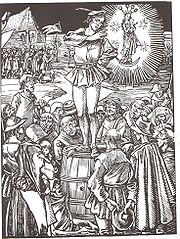 Grafik von Rudolf Schiestl
Grafik von Rudolf SchiestlKlausGraf - am Sonntag, 18. April 2010, 19:43 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://lagis.online.uni-marburg.de/de/subjects/index/sn/bio
Die Hessische Biografie präsentiert sich mit einem einfachen Suchschlitz in Google-Manier. Fürs Browsen muss man links den Menüpunkt "Entdecken" entdecken.
Die Biographien sind sehr unterschiedlich ausführlich. Beispiel für den Mindest-Standard:
Müller, Heinrich Fidelis
* 23.4.1837 Fulda, † 30.8.1905 Fulda
Priester, Komponist
Literatur:
Michael Mott, Fuldaer Köpfe, 2007, 86-88.
Kassellexikon 2, S. 84 f.
Bearbeiter:
L. v. Lehsten
Bildquelle:
Kassellexikon 2, S. 84
Zitierweise ↑
„Müller, Heinrich Fidelis“, in: Hessische Biografie < https://www.lagis-hessen.de//de/subjects/idrec/sn/bio/id/1699 > (Stand: 8.4.2010)
Es sind (zu kleine) Bilder beigegeben, erfreulicherweise ist die Bildquelle genannt. Leider aber nicht immer, etwa bei Grimmelshausen, wo ein möglicherweise nicht authentisches Bildnis (siehe Wikipedia) ohne nähere Angaben abgebildet wird:
https://www.lagis-hessen.de//pnd/118542273
Bei den längeren Artikeln verlinkt die Hessische Biografie ärgerlicherweise (anders als die DNB) nicht immer auf die Wikipedia.
Wikipedia-Link dagegen vorhanden:
https://www.lagis-hessen.de//pnd/118529927
Vollständigkeit: Angaben zur Vollständigkeit bzw. zu den erschöpfend ausgewerteten Literatur- oder Datenquellen fehlen. Es gibt keinen einzigen Artikel zu einem Angehörigen der Herren von Hirschhorn!
Auch zu Erwin Stein gibt es keinen Artikel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Erwin_Stein_(Politiker)
Untereinander sind die Artikel vernetzt, ebenso innerhalb des Portals. Bei Gertrud von Altenberg wird auf den Grabstein im Grabdenkmäler-Bereich verwiesen, aber leider funktioniert der Link nicht:
https://www.lagis-hessen.de//de/subjects/idrec/sn/bio/id/2381
In diesem Artikel vermisst man u.a. die Verlinkung zum HEBIS-Katalog: "Renkhoff, Nassauische Biographie 2. Aufl. 1283" ist ohne Link oder Auflösung nicht akzeptabel.
Der Wikipedia entnimmt man, dass Gertrud eine PND hat, die die Hessische Biografie unterschlägt (obwohl andere Artikel sie angeben).
Unter den Literaturangaben hätte ein kunsthistorischer Beitrag nicht fehlen dürfen:
Nassauische Grablege und Kultstätte für die selige Gertrud : zur Ausstattung der Klosterkirche Altenberg/Lahn zwischen 1290 und 1350 / Daniel Hess. – 1996
In: Städel-Jahrbuch, N.F. 15.1995(1996), p. 35-52 (zitiert in einem der ersten Google-Treffer unter Gertrud Altenberg)
Eine Verknüpfung zur Hessischen Bibliographie, wo man weitere Arbeiten zu Gertrud findet, existiert nicht.
Anders bei Elisabeth von Thüringen:
https://www.lagis-hessen.de//pnd/118529927
Obwohl die Person hochbedeutend ist, fehlt eine Kurzbiographie. Im Literaturverzeichnis ist der online kostenfrei zugängliche DA-Aufsatz nicht mit einem Link versehen. Der Bildnachweis enthält keine Angaben zu den Rechten bzw. zum Fotografen.
Gern hätte ich noch weiteres mitgeteilt, aber das Datenbankangebot nimmt offensichtlich zu viele Recherchen übel und reagiert dann mit
Fatal error: Cannot redeclare class Zend_Filter_Interface in /usr/local/ZendFramework/library/Zend/Filter/Interface.php on line 30
Fazit: Die Hessische Biografie ist ein nützliches biographisches Online-Nachschlagewerk, das sich jedoch sehr uneinheitlich darstellt und deutliche Mängel aufweist.
Update: Die Netzbürger werden von der Hessischen Biografie wie gehabt ignoriert, keine Mitteilung z.B. an H-SOZ-U-KULT. Man muss in der Lampertheimer Zeitung nachschlagen, um Näheres zu erfahren:
"Auf Initiative von Lupold von Lehsten vom Institut für Persoengeschichte umfasst Lagis jetzt neu eine hessische Biografie. Hier finden sich alle Personen, die in Hessen öffentlich wirkten, hier geboren wurden oder starben. Mit Ausnahme der Regierungsmitglieder und der Parlamentarier umfasst das System nur Personen, die nicht mehr leben.
Aktuell lassen sich 5500 Biografien recherchieren."
https://www.lampertheimer-zeitung.de/region/rhein-main-hessen/8755238.htm
Siehe auch
https://www.kultur-hessen.de/de/Aktuelle_Kulturnachrichten/Fuenf_Jahre_LAGIS/index.phtml
Update etwas später: Das Angebot funktioniert wieder. Die Liste der Kinder des Vaters von Jacob Grimm ist unvollständig, beim Vater gibt es überhaupt keine Nachweise (so etwas leistet sich inzwischen nicht mal die Wikipedia mehr):
https://www.lagis-hessen.de//de/subjects/idrec/sn/bio/id/3329
Die Hessische Biografie präsentiert sich mit einem einfachen Suchschlitz in Google-Manier. Fürs Browsen muss man links den Menüpunkt "Entdecken" entdecken.
Die Biographien sind sehr unterschiedlich ausführlich. Beispiel für den Mindest-Standard:
Müller, Heinrich Fidelis
* 23.4.1837 Fulda, † 30.8.1905 Fulda
Priester, Komponist
Literatur:
Michael Mott, Fuldaer Köpfe, 2007, 86-88.
Kassellexikon 2, S. 84 f.
Bearbeiter:
L. v. Lehsten
Bildquelle:
Kassellexikon 2, S. 84
Zitierweise ↑
„Müller, Heinrich Fidelis“, in: Hessische Biografie < https://www.lagis-hessen.de//de/subjects/idrec/sn/bio/id/1699 > (Stand: 8.4.2010)
Es sind (zu kleine) Bilder beigegeben, erfreulicherweise ist die Bildquelle genannt. Leider aber nicht immer, etwa bei Grimmelshausen, wo ein möglicherweise nicht authentisches Bildnis (siehe Wikipedia) ohne nähere Angaben abgebildet wird:
https://www.lagis-hessen.de//pnd/118542273
Bei den längeren Artikeln verlinkt die Hessische Biografie ärgerlicherweise (anders als die DNB) nicht immer auf die Wikipedia.
Wikipedia-Link dagegen vorhanden:
https://www.lagis-hessen.de//pnd/118529927
Vollständigkeit: Angaben zur Vollständigkeit bzw. zu den erschöpfend ausgewerteten Literatur- oder Datenquellen fehlen. Es gibt keinen einzigen Artikel zu einem Angehörigen der Herren von Hirschhorn!
Auch zu Erwin Stein gibt es keinen Artikel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Erwin_Stein_(Politiker)
Untereinander sind die Artikel vernetzt, ebenso innerhalb des Portals. Bei Gertrud von Altenberg wird auf den Grabstein im Grabdenkmäler-Bereich verwiesen, aber leider funktioniert der Link nicht:
https://www.lagis-hessen.de//de/subjects/idrec/sn/bio/id/2381
In diesem Artikel vermisst man u.a. die Verlinkung zum HEBIS-Katalog: "Renkhoff, Nassauische Biographie 2. Aufl. 1283" ist ohne Link oder Auflösung nicht akzeptabel.
Der Wikipedia entnimmt man, dass Gertrud eine PND hat, die die Hessische Biografie unterschlägt (obwohl andere Artikel sie angeben).
Unter den Literaturangaben hätte ein kunsthistorischer Beitrag nicht fehlen dürfen:
Nassauische Grablege und Kultstätte für die selige Gertrud : zur Ausstattung der Klosterkirche Altenberg/Lahn zwischen 1290 und 1350 / Daniel Hess. – 1996
In: Städel-Jahrbuch, N.F. 15.1995(1996), p. 35-52 (zitiert in einem der ersten Google-Treffer unter Gertrud Altenberg)
Eine Verknüpfung zur Hessischen Bibliographie, wo man weitere Arbeiten zu Gertrud findet, existiert nicht.
Anders bei Elisabeth von Thüringen:
https://www.lagis-hessen.de//pnd/118529927
Obwohl die Person hochbedeutend ist, fehlt eine Kurzbiographie. Im Literaturverzeichnis ist der online kostenfrei zugängliche DA-Aufsatz nicht mit einem Link versehen. Der Bildnachweis enthält keine Angaben zu den Rechten bzw. zum Fotografen.
Gern hätte ich noch weiteres mitgeteilt, aber das Datenbankangebot nimmt offensichtlich zu viele Recherchen übel und reagiert dann mit
Fatal error: Cannot redeclare class Zend_Filter_Interface in /usr/local/ZendFramework/library/Zend/Filter/Interface.php on line 30
Fazit: Die Hessische Biografie ist ein nützliches biographisches Online-Nachschlagewerk, das sich jedoch sehr uneinheitlich darstellt und deutliche Mängel aufweist.
Update: Die Netzbürger werden von der Hessischen Biografie wie gehabt ignoriert, keine Mitteilung z.B. an H-SOZ-U-KULT. Man muss in der Lampertheimer Zeitung nachschlagen, um Näheres zu erfahren:
"Auf Initiative von Lupold von Lehsten vom Institut für Persoengeschichte umfasst Lagis jetzt neu eine hessische Biografie. Hier finden sich alle Personen, die in Hessen öffentlich wirkten, hier geboren wurden oder starben. Mit Ausnahme der Regierungsmitglieder und der Parlamentarier umfasst das System nur Personen, die nicht mehr leben.
Aktuell lassen sich 5500 Biografien recherchieren."
https://www.lampertheimer-zeitung.de/region/rhein-main-hessen/8755238.htm
Siehe auch
https://www.kultur-hessen.de/de/Aktuelle_Kulturnachrichten/Fuenf_Jahre_LAGIS/index.phtml
Update etwas später: Das Angebot funktioniert wieder. Die Liste der Kinder des Vaters von Jacob Grimm ist unvollständig, beim Vater gibt es überhaupt keine Nachweise (so etwas leistet sich inzwischen nicht mal die Wikipedia mehr):
https://www.lagis-hessen.de//de/subjects/idrec/sn/bio/id/3329
KlausGraf - am Sonntag, 18. April 2010, 16:29 - Rubrik: Landesgeschichte
https://de.wikisource.org/wiki/Das_Passionsspiel_in_Schw%C3%A4bisch-Gm%C3%BCnd
Weitere Materialien:
https://de.wikisource.org/wiki/Passionsspiel_Schw%C3%A4bisch_Gm%C3%BCnd

Weitere Materialien:
https://de.wikisource.org/wiki/Passionsspiel_Schw%C3%A4bisch_Gm%C3%BCnd

KlausGraf - am Freitag, 16. April 2010, 00:47 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Rudolf Scharl: Neidharts Reuental – eine Suche im Erdinger Land
https://cma.gbv.de/dr,cma,013,2010,a,04.pdf
"Bei der Prüfung der Kriterien konnte aber auch kein Argument gefunden
werden, das eine Zuordnung von Riffenthal zu Neidharts Reuental ausschließt.
Vielmehr ist die erstaunliche Korrelation von Aussagen seiner Dichtung mit
der Situation des mittelalterlichen Riffenthals festzuhalten. Mit Riffenthal
werden Neidharts literarische Aussagen räumlich greifbar."
Bei allem Scharfsinn: Neidharts Texte positivistisch auf Topographisches abzuklopfen, ist methodisch im Ansatz verfehlt.
https://cma.gbv.de/dr,cma,013,2010,a,04.pdf
"Bei der Prüfung der Kriterien konnte aber auch kein Argument gefunden
werden, das eine Zuordnung von Riffenthal zu Neidharts Reuental ausschließt.
Vielmehr ist die erstaunliche Korrelation von Aussagen seiner Dichtung mit
der Situation des mittelalterlichen Riffenthals festzuhalten. Mit Riffenthal
werden Neidharts literarische Aussagen räumlich greifbar."
Bei allem Scharfsinn: Neidharts Texte positivistisch auf Topographisches abzuklopfen, ist methodisch im Ansatz verfehlt.
KlausGraf - am Dienstag, 13. April 2010, 00:34 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen