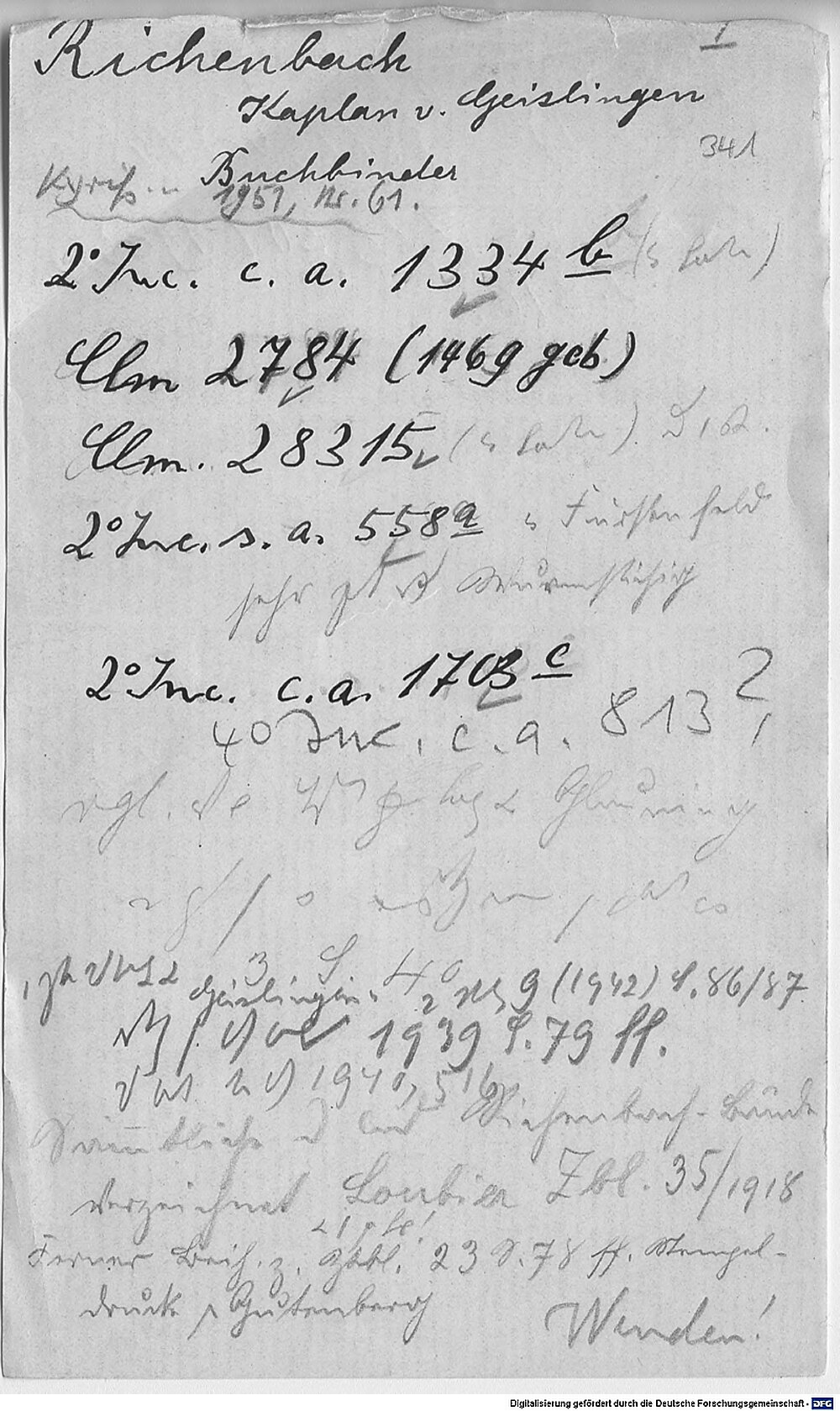Hilfswissenschaften
KlausGraf - am Samstag, 31. Oktober 2009, 00:26 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.tlulib.ee/incunabula/
Sehr behindert wird die Benutzbarkeit der Datenbank durch die tatsache, dass nur eine estnische Suchoberfläche vorliegt. Angegeben werden auch Provenienzen, und es sind vielfach Schlüsselseiten digitalisiert. Eine Schedelchronik ohne solche Schlüsselseiten wurde offenbar von der UB Freiburg als Dublette vertickt: "Puulõikeinitsiaalid; ehisinitsiaalid; ostetud 1830. a. Freiburgist Breisgaus sealse ülikooli raamatukogu dublettide oksjonilt; sisaldab käsikirjalisi märkusi; puukaantega, maarjasparknahast köide; dekoor pimetrükitehnikas; sulgurite plaatvastused".

Sehr behindert wird die Benutzbarkeit der Datenbank durch die tatsache, dass nur eine estnische Suchoberfläche vorliegt. Angegeben werden auch Provenienzen, und es sind vielfach Schlüsselseiten digitalisiert. Eine Schedelchronik ohne solche Schlüsselseiten wurde offenbar von der UB Freiburg als Dublette vertickt: "Puulõikeinitsiaalid; ehisinitsiaalid; ostetud 1830. a. Freiburgist Breisgaus sealse ülikooli raamatukogu dublettide oksjonilt; sisaldab käsikirjalisi märkusi; puukaantega, maarjasparknahast köide; dekoor pimetrükitehnikas; sulgurite plaatvastused".
KlausGraf - am Freitag, 30. Oktober 2009, 23:57 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
Endlich auch ohne Citrix-Klient benutzbar! Aber immer noch ärgerlich: Es ist keine Eingabe von Suchbegriffen in Kleinbuchstaben möglich.
Endlich auch ohne Citrix-Klient benutzbar! Aber immer noch ärgerlich: Es ist keine Eingabe von Suchbegriffen in Kleinbuchstaben möglich.
KlausGraf - am Mittwoch, 28. Oktober 2009, 13:52 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 14. Oktober 2009, 14:02 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Niklot Klüßendorf: Münzkunde. Basiswissen (Hahnsche Historische Hilfswissenschaften Bd. 5). Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung 2009. 128 S., 39 Schwarzweißabbildungen. 14,80 Euro.
Inhaltsverzeichnis (PDF)
Vor mir liegt ein ein schmaler, aber gehaltvoller Band, verfasst von dem Marburger Numismatiker und langjährigen Archivschul-Dozenten Niklot Klüßendorf, eine komprimierte Einführung in die Numismatik, die nicht zuletzt durch das Plädoyer gegen die Verdrängung der Historischen Hilfswissenschaften und die Betonung der Archivpraxis für sich einnimmt. Gerade der Archivar wird von dieser bündigen Zusammenfassung profitieren, denn die archivischen Quellen sind breit berücksichtigt.
Kapitel I skizziert vor allem die Wissenschaftsgeschichte der Numismatik. Kapitel II hat einen quellenkundlichen Schwerpunkt: Vorgestellt werden die Münzen und Geldzeichen, Münzfunde als Quellengattung und die schriftlichen Quellen, in denen numismatische Sachverhalte erscheinen. Vergleichsweise knapp wird die Geldgeschichte gewürdigt. Besonders verdienstvoll erscheint mir die in Kapitel IV vorgenommene Verzahnung mit den anderen Hilfswissenschaften: mit Diplomatik, Aktenkunde, Paläographie, Chronologie, Heraldik, Phaleristik (Ordenskunde), Sphragistik (Siegelkunde), Genealogie, Onomastik (Namenskunde), Metrologie (Kunde des Maßwesens), Historische Bildkunde. Institutionen, die sich mit Numismatik beschäftigen, stellt Kapitel V vor (zu den Archiven S. 71). Ein "Schnelldurchlauf" durch die Münzgeschichte von den karolingischen Münzreformen bis zum Euro in 12 knappen Abschnitten beschließt den Darstellungsteil.
Das empfehlenswerte Bändchen verzichtet auf Einzelnachweise, gibt aber kapitelweise bibliografische Hinweise, mitunter mit nützlichen Kommentaren versehen. Ein Index erschließt Namen und Sachbegriffe.
Zwei kleine Monita: 1. Was Klüßendorf S. 9 über die Anfänge der Beschäftigung mit Münzen in der Renaissance schreibt, befriedigt nicht. Ergänzend sei auf Francis Haskell, Die Geschichte und ihre Bilder, München 1995, S. 23-36: Die frühen Numismatiker verwiesen. Klüßendorf erwähnt eine "Reimchronik des Matthias von Neidenburg", die gar nicht existiert. Gemeint ist offenbar eine Bemerkung in Grunaus preußischer Chronik über den Kulmer Bischof Stephan Matthias von Neidenburg. 2. Zwar ist die Digitalisierung der Numismatik im Vergleich etwa zur Handschriftenforschung stark im Hintertreffen, aber dass die bibliografischen Angaben keine einzige Internetquelle nennen, ist nicht hinzunehmen. Man kann das Internet nicht dadurch aus der Welt schaffen, dass man es ignoriert.
Update: Prof. Klüßendorf war so freundlich, auf seine sehr instruktive Internetseite zur Numismatik aufmerksam zu machen:
https://www.hlgl.de/numismatik_inhalt.html
Update: Thomas Czerner: Rezension zu: Klüßendorf, Niklot: Münzkunde. Basiswissen. Hannover 2009, in: H-Soz-u-Kult, 17.02.2010, https://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2010-1-122

#numismatik
Inhaltsverzeichnis (PDF)
Vor mir liegt ein ein schmaler, aber gehaltvoller Band, verfasst von dem Marburger Numismatiker und langjährigen Archivschul-Dozenten Niklot Klüßendorf, eine komprimierte Einführung in die Numismatik, die nicht zuletzt durch das Plädoyer gegen die Verdrängung der Historischen Hilfswissenschaften und die Betonung der Archivpraxis für sich einnimmt. Gerade der Archivar wird von dieser bündigen Zusammenfassung profitieren, denn die archivischen Quellen sind breit berücksichtigt.
Kapitel I skizziert vor allem die Wissenschaftsgeschichte der Numismatik. Kapitel II hat einen quellenkundlichen Schwerpunkt: Vorgestellt werden die Münzen und Geldzeichen, Münzfunde als Quellengattung und die schriftlichen Quellen, in denen numismatische Sachverhalte erscheinen. Vergleichsweise knapp wird die Geldgeschichte gewürdigt. Besonders verdienstvoll erscheint mir die in Kapitel IV vorgenommene Verzahnung mit den anderen Hilfswissenschaften: mit Diplomatik, Aktenkunde, Paläographie, Chronologie, Heraldik, Phaleristik (Ordenskunde), Sphragistik (Siegelkunde), Genealogie, Onomastik (Namenskunde), Metrologie (Kunde des Maßwesens), Historische Bildkunde. Institutionen, die sich mit Numismatik beschäftigen, stellt Kapitel V vor (zu den Archiven S. 71). Ein "Schnelldurchlauf" durch die Münzgeschichte von den karolingischen Münzreformen bis zum Euro in 12 knappen Abschnitten beschließt den Darstellungsteil.
Das empfehlenswerte Bändchen verzichtet auf Einzelnachweise, gibt aber kapitelweise bibliografische Hinweise, mitunter mit nützlichen Kommentaren versehen. Ein Index erschließt Namen und Sachbegriffe.
Zwei kleine Monita: 1. Was Klüßendorf S. 9 über die Anfänge der Beschäftigung mit Münzen in der Renaissance schreibt, befriedigt nicht. Ergänzend sei auf Francis Haskell, Die Geschichte und ihre Bilder, München 1995, S. 23-36: Die frühen Numismatiker verwiesen. Klüßendorf erwähnt eine "Reimchronik des Matthias von Neidenburg", die gar nicht existiert. Gemeint ist offenbar eine Bemerkung in Grunaus preußischer Chronik über den Kulmer Bischof Stephan Matthias von Neidenburg. 2. Zwar ist die Digitalisierung der Numismatik im Vergleich etwa zur Handschriftenforschung stark im Hintertreffen, aber dass die bibliografischen Angaben keine einzige Internetquelle nennen, ist nicht hinzunehmen. Man kann das Internet nicht dadurch aus der Welt schaffen, dass man es ignoriert.
Update: Prof. Klüßendorf war so freundlich, auf seine sehr instruktive Internetseite zur Numismatik aufmerksam zu machen:
https://www.hlgl.de/numismatik_inhalt.html
Update: Thomas Czerner: Rezension zu: Klüßendorf, Niklot: Münzkunde. Basiswissen. Hannover 2009, in: H-Soz-u-Kult, 17.02.2010, https://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2010-1-122
#numismatik
KlausGraf - am Montag, 5. Oktober 2009, 01:02 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Als die Lettern laufen lernten. Medienwandel im 15. Jahrhundert. Inkunabeln aus der Bayerischen Staatsbibliothek München (Bayerische Staatsbibliothek, Ausstellungskataloge Nr.81). Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag 2009. 240 S., zahlreiche Farbabbildungen. 19,90 Euro.
Der vorliegende opulente und recht preisgünstige Ausstellungskatalog feiert den Beginn des Buchdrucks. Nach einer kenntnisreichen Einführung von Bettina Wagner werden in 85 Katalognummern schöne oder interessante Inkunabeln und einige Holztafeldrucke bzw. Handschriften präsentiert. Den informativen Texten diverser Experten - der ganze Band ist konsequent deutsch-englisch gehalten - sind großformatige Abbildungen beigegeben. Am Ende findet sich ein nützliches Glossar. Wer sich für Inkunabeln interessiert, sollte sich dieses Buch nicht entgehen lassen.
Ist es ein Zufall, dass der von dem Antiquariat Tenschert gesponsorte Band den Medienwandel des 21. Jahrhunderts nur ganz am Rande reflektiert? Liegt womöglich ein Abgesang auf die traditionelle Druckkultur vor, der die angebliche Bedrohung ausblendet? Wieso fehlt bei den Exponatbeschreibungen jeglicher Hinweis auf die inzwischen stattliche Zahl der Münchner Inkunabeldigitalisate? Wieso werden auch sonst Internetquellen (z.B. der Handschriftencensus, an dem Frau Wagner an sich beteiligt ist) ignoriert? Wieso ist der Band nicht auch als Volltext im Internet vorhanden? Das Internet wird die Bibliophilie nicht erwürgen, davon bin ich fest überzeugt. Falk Eisermann vom GW stellt in Nr. 37 die Reste einer verlorenen Ausgabe der Visio Tnugdali, deutsch vor, die bei der Analyse eines Münchner Inkunabeldigitalisats entdeckt wurden. Das Internet hilft der Inkunabelforschung ungemein - wieso muss man dann so tun, als sei es nicht existent?
Eine kleine Bemerkung zu Nr. 5, Lirers Chronik und Gmünder Kaiserchronik. Elisabeth Wunderle schreibt dort: "Ob es sich bei Thomas Lirer, der sich am Schluss als Verfasser nennt, um einen wirklichen Namen oder um ein Pseudonym handelt, ist nicht geklärt" (S. 33). Richtig ist: Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass es sich um einen wirklichen Namen handelt.
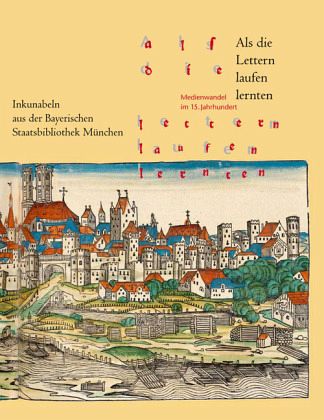


Der vorliegende opulente und recht preisgünstige Ausstellungskatalog feiert den Beginn des Buchdrucks. Nach einer kenntnisreichen Einführung von Bettina Wagner werden in 85 Katalognummern schöne oder interessante Inkunabeln und einige Holztafeldrucke bzw. Handschriften präsentiert. Den informativen Texten diverser Experten - der ganze Band ist konsequent deutsch-englisch gehalten - sind großformatige Abbildungen beigegeben. Am Ende findet sich ein nützliches Glossar. Wer sich für Inkunabeln interessiert, sollte sich dieses Buch nicht entgehen lassen.
Ist es ein Zufall, dass der von dem Antiquariat Tenschert gesponsorte Band den Medienwandel des 21. Jahrhunderts nur ganz am Rande reflektiert? Liegt womöglich ein Abgesang auf die traditionelle Druckkultur vor, der die angebliche Bedrohung ausblendet? Wieso fehlt bei den Exponatbeschreibungen jeglicher Hinweis auf die inzwischen stattliche Zahl der Münchner Inkunabeldigitalisate? Wieso werden auch sonst Internetquellen (z.B. der Handschriftencensus, an dem Frau Wagner an sich beteiligt ist) ignoriert? Wieso ist der Band nicht auch als Volltext im Internet vorhanden? Das Internet wird die Bibliophilie nicht erwürgen, davon bin ich fest überzeugt. Falk Eisermann vom GW stellt in Nr. 37 die Reste einer verlorenen Ausgabe der Visio Tnugdali, deutsch vor, die bei der Analyse eines Münchner Inkunabeldigitalisats entdeckt wurden. Das Internet hilft der Inkunabelforschung ungemein - wieso muss man dann so tun, als sei es nicht existent?
Eine kleine Bemerkung zu Nr. 5, Lirers Chronik und Gmünder Kaiserchronik. Elisabeth Wunderle schreibt dort: "Ob es sich bei Thomas Lirer, der sich am Schluss als Verfasser nennt, um einen wirklichen Namen oder um ein Pseudonym handelt, ist nicht geklärt" (S. 33). Richtig ist: Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass es sich um einen wirklichen Namen handelt.
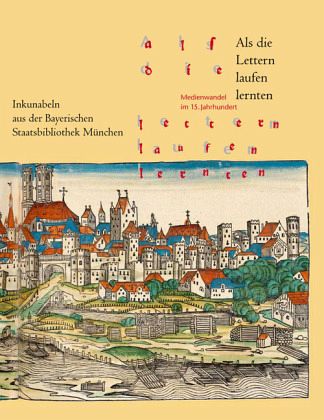


KlausGraf - am Sonntag, 4. Oktober 2009, 01:09 - Rubrik: Hilfswissenschaften
KlausGraf - am Donnerstag, 3. September 2009, 05:57 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus der Liste diskus:
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in der Amploniana befindet sich eine Gruppe gleichartiger Einbände, die wohl im ersten Viertel des 15. Jhs. im Großraum Mainz (eventuell auch in Mainz selbst) gebunden wurden. Es handelt sich um Halbbände aus Schweinsleder, mit signifikanter roter Lederbordüre als Abschluss und (neben anderen) einem sehr auffälligen S-Stempel im Quadrat mit einer Art Perlbordüre.
In den einschlägigen Repertorien finde ich diese Werkstatt bisher nicht. Daher habe ich die signifikantesten Stempel dieser Einbandgruppe (S, Löwe oder Panther (2 Bilder der Deutlichkeit halber), Adler) nun auf unsere Homepage hochgeladen
https://www.uni-erfurt.de/amploniana/bilderschauen/bilderoffline/
und bitte Sie, vielleicht einmal einen Blick darauf zu werfen. - Möglicherweise sind gleichartige Einbände ja noch in anderen Sammlungen erhalten.
Der S-Stempel ist offenbar 'Leitstempel', da er nur auf dem Einband einer Oktavhandschrift fehlt. - Dieser Stempel bzw. ein sehr ähnlicher war wohl auch noch am Ende des 15. Jhs. im Gebrauch. Doch stimmen die begleitenden Stempel hier ebensowenig mit denen meiner Gruppe überein wie der Einband insgesamt, der in diesem Fall komplett mit dunkelbraunem Rindleder bezogen ist.
Danke und Grüße
Brigitte Pfeil
--
Dr. Brigitte Pfeil
___________________________________________________
Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha
Universitätsbibliothek
Sondersammlung
DFG-Projekt 'Erschließung der Codices Amploniani'
&
Forschungsprojekt 'Amploniana' der Katholisch-
Theologischen Fakultät
Nordhäuser Straße 63
D-99089 Erfurt
Tel: +49 (0)361 737-5884 /-5880: Lesesaal
Fax: +49 (0)361 737-5779
Mail: brigitte.pfeil@uni-erfurt.de
Web: https://www.uni-erfurt.de/amploniana

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in der Amploniana befindet sich eine Gruppe gleichartiger Einbände, die wohl im ersten Viertel des 15. Jhs. im Großraum Mainz (eventuell auch in Mainz selbst) gebunden wurden. Es handelt sich um Halbbände aus Schweinsleder, mit signifikanter roter Lederbordüre als Abschluss und (neben anderen) einem sehr auffälligen S-Stempel im Quadrat mit einer Art Perlbordüre.
In den einschlägigen Repertorien finde ich diese Werkstatt bisher nicht. Daher habe ich die signifikantesten Stempel dieser Einbandgruppe (S, Löwe oder Panther (2 Bilder der Deutlichkeit halber), Adler) nun auf unsere Homepage hochgeladen
https://www.uni-erfurt.de/amploniana/bilderschauen/bilderoffline/
und bitte Sie, vielleicht einmal einen Blick darauf zu werfen. - Möglicherweise sind gleichartige Einbände ja noch in anderen Sammlungen erhalten.
Der S-Stempel ist offenbar 'Leitstempel', da er nur auf dem Einband einer Oktavhandschrift fehlt. - Dieser Stempel bzw. ein sehr ähnlicher war wohl auch noch am Ende des 15. Jhs. im Gebrauch. Doch stimmen die begleitenden Stempel hier ebensowenig mit denen meiner Gruppe überein wie der Einband insgesamt, der in diesem Fall komplett mit dunkelbraunem Rindleder bezogen ist.
Danke und Grüße
Brigitte Pfeil
--
Dr. Brigitte Pfeil
___________________________________________________
Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha
Universitätsbibliothek
Sondersammlung
DFG-Projekt 'Erschließung der Codices Amploniani'
&
Forschungsprojekt 'Amploniana' der Katholisch-
Theologischen Fakultät
Nordhäuser Straße 63
D-99089 Erfurt
Tel: +49 (0)361 737-5884 /-5880: Lesesaal
Fax: +49 (0)361 737-5779
Mail: brigitte.pfeil@uni-erfurt.de
Web: https://www.uni-erfurt.de/amploniana

KlausGraf - am Donnerstag, 27. August 2009, 14:37 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 20. August 2009, 17:59 - Rubrik: Hilfswissenschaften
https://app.olg-ol.niedersachsen.de/efundus/volltext.php4?id=5049
OLG Celle, 01. Strafsenat, Beschluss, 1 Ws 248/09 vom 19.05.2009
Leitsatz: Allein der Umstand, dass der Schriftverkehr eines Gefangenen vollständig oder zum Teil in „Sütterlinschrift“ bzw. „Deutscher Schreibschrift“ abgefasst ist, rechtfertigt nicht die generelle Anordnung des Anhaltens derartiger Schreiben gemäß § 31 NJVollzG.
Auszug:
Eine konkrete Gefahr durch den Inhalt des Schriftverkehrs hat die Strafvollstreckungskammer nicht festgestellt. eine solche wurde von der Antragsgegnerin auch nicht zur Begründung ihrer Maßnahme angeführt. Zwar kann auch der Umfang des Schriftverkehrs eines Gefangenen grundsätzlich Maßnahmen der Anstalt nach § 31 NJVollzG rechfertigen. Dies setzt aber voraus, dass die Kontrolle des Schriftverkehrs einen so übermäßigen Aufwand erfordert, dass die mit der Kontrolle betrauten Bediensteten insgesamt überlastet sind und nicht ohne Beeinträchtigung anderer Aufgaben entlastet werden können. nur dann wäre eine Gefährdung der Ordnung der Anstalt im Sinne des § 31 Abs. 1 Nr. 1 NJVollzG anzunehmen (vgl. OLG Celle ZfStrVo 1985, 184. OLG Hamm NStZ 1989, 359 bei Bungert). Auch eine derartige Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung hat die Strafvollstreckungskammer vorliegend nicht festgestellt. sie ergibt sich auch nicht aus dem Sachvortrag der Antragsgegnerin. Vielmehr ist diesem zu entnehmen, dass nicht der Umfang des Schriftverkehrs an sich, sondern die verwendete Schriftart Anknüpfungspunkt für die Maßnahme ist. Abgesehen davon wäre bei einer Gefährdung der Ordnung durch den Kontrollaufwand regelmäßig nur eine Begrenzung des Schriftverkehrs auf ein zumutbares Maß, nicht aber eine generelle Anhalteanordnung gerechtfertigt (ebenda).
Dementsprechend könnte als Rechtsgrundlage für die Maßnahme nur § 31 Abs. 1 Nr. 6 NJVollzG in Betracht kommen. Danach können Schreiben angehalten werden, wenn sie in Geheimschrift, unlesbar, unverständlich oder ohne zwingenden Grund in einer fremden Sprache abgefasst sind. Indes ist keine dieser Voraussetzungen durch das Verwenden von Sütterlinschrift bzw. Deutscher Schreibschrift erfüllt.
Sütterlinschrift ist eine von dem Berliner Grafiker Ludwig Sütterlin um 1911 im Auftrag des preußischen Kulturministeriums geschaffene Schreibschrift. Sie wurde verschiedenen Orts erprobt, leicht abgeändert und war die Grundlage der 1935 an den deutschen Schulen als „Normalschrift“ eingeführten „Deutschen Schreibschrift“. 1941 wurde die „Deutsche Schreibschrift“ durch die „Deutsche Normalschrift“, eine lateinische Schreibschrift, ersetzt. Diese wiederum wurde 1952 durch den „Iserlohner Schreibkreis“ neu gestaltet und in modifizierter Form 1954 von der Kultusministerkonferenz als „Lateinische Ausgangsschrift“ zur Grundlage des Schreibunterrichts in allen Bundesländern gemacht. Parallel dazu wurde - in einigen Bundesländern zum Teil bis in die 1990er Jahre - die Sütterlinschrift als weitere Schriftart zumindest im Leseunterricht an bundesdeutschen Schulen gelehrt (vgl. Brockhaus Enzyklopädie, 19. Aufl.).
Hiernach liegt es zunächst auf der Hand, dass Sütterlinschrift bzw. Deutsche Schreibschrift keine Geheimschrift ist. Auch die Benutzung einer fremden Sprache ist nicht festzustellen. Zwar können Schreiben mittels Sütterlinschrift bzw. Deutscher Schreibschrift auch in einer fremden Sprache abgefasst werden, weil es sich dabei eben nur um Schriftarten handelt. Dass der Antragsteller und seine Verlobte vorliegend eine fremde Sprache benutzen, hat die Antragsgegnerin indes nicht vorgetragen. Das Tatbestandsmerkmal „unverständlich“ knüpft ersichtlich an den Inhalt des Schreibens an und ist deshalb im vorliegenden Fall, in dem es lediglich um die Form des Schreibens geht, ebenfalls nicht einschlägig. Somit verbleibt „unlesbar“ als einzig in Betracht kommendes Tatbestandsmerkmal. Nach welchen Kriterien sich die Lesbarkeit eines Schreibens beurteilt, ist im Gesetz nicht geregelt. Verbindliche Vorschriften darüber, welche Schriftart im Schriftverkehr zu verwenden ist, existieren in Deutschland nicht. Es finden sich nur Regelungen der Bundesländer darüber, welche Schriften im schulischen Schreibunterricht gelehrt werden. Dies sind nach heutigem Stand die Druckschrift als Erstschrift sowie die Lateinische Ausgangsschrift und die Vereinfachte Ausgangsschrift als weitere Schriften (vgl. Bartnitzky in „GS aktuell“ Heft 91/September 2005, 3 ff.). Was hiernach im Allgemeinen als „lesbar“ angesehen wird, ist somit davon abhängig, welche Schriften der Bevölkerungsdurchschnitt in der Schule zu lesen gelernt hat und wie „formklar“ (vgl. Bartnitzky aaO, 10) diese Schrift dann vom jeweiligen Verfasser in der Ausprägung seiner persönlichen Handschrift verwendet wird. Da die Antragsgegnerin allein auf die verwendete Schriftart, nicht auf die persönliche Handschrift des Antragstellers und seiner Verlobten abstellt, ist hier nur jenes Kriterium maßgeblich. Hierzu stellt der Senat als allgemeinkundig fest, dass Sütterlinschrift bzw. Deutsche Schreibschrift zwar schon seit Jahrzehnten nicht mehr Grundlage des Schreibunterrichts an deutschen Schulen sind, diese Schriften aber nach wie vor von weiten Teilen der Bevölkerung zumindest gelesen werden können. Unstreitig sind auch Bedienstete der Antragsgegnerin in der Lage, diese Schriften zu lesen. Dies mag sich in Zukunft ändern, wie auch der Schreibunterricht in den Schulen ständigen Wandlungen unterworfen ist (vgl. Bartnitzky aaO), derzeit ist es aber noch Stand der gesellschaftlichen Entwicklung.
Da hiernach die Verwendung von Sütterlinschrift bzw. Deutscher Schreibschrift keinen Verbotstatbestand des Gesetzes erfüllt, bedurfte der Antragsteller für die Verwendung dieser Schriften auch keiner Erlaubnis.
OLG Celle, 01. Strafsenat, Beschluss, 1 Ws 248/09 vom 19.05.2009
Leitsatz: Allein der Umstand, dass der Schriftverkehr eines Gefangenen vollständig oder zum Teil in „Sütterlinschrift“ bzw. „Deutscher Schreibschrift“ abgefasst ist, rechtfertigt nicht die generelle Anordnung des Anhaltens derartiger Schreiben gemäß § 31 NJVollzG.
Auszug:
Eine konkrete Gefahr durch den Inhalt des Schriftverkehrs hat die Strafvollstreckungskammer nicht festgestellt. eine solche wurde von der Antragsgegnerin auch nicht zur Begründung ihrer Maßnahme angeführt. Zwar kann auch der Umfang des Schriftverkehrs eines Gefangenen grundsätzlich Maßnahmen der Anstalt nach § 31 NJVollzG rechfertigen. Dies setzt aber voraus, dass die Kontrolle des Schriftverkehrs einen so übermäßigen Aufwand erfordert, dass die mit der Kontrolle betrauten Bediensteten insgesamt überlastet sind und nicht ohne Beeinträchtigung anderer Aufgaben entlastet werden können. nur dann wäre eine Gefährdung der Ordnung der Anstalt im Sinne des § 31 Abs. 1 Nr. 1 NJVollzG anzunehmen (vgl. OLG Celle ZfStrVo 1985, 184. OLG Hamm NStZ 1989, 359 bei Bungert). Auch eine derartige Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung hat die Strafvollstreckungskammer vorliegend nicht festgestellt. sie ergibt sich auch nicht aus dem Sachvortrag der Antragsgegnerin. Vielmehr ist diesem zu entnehmen, dass nicht der Umfang des Schriftverkehrs an sich, sondern die verwendete Schriftart Anknüpfungspunkt für die Maßnahme ist. Abgesehen davon wäre bei einer Gefährdung der Ordnung durch den Kontrollaufwand regelmäßig nur eine Begrenzung des Schriftverkehrs auf ein zumutbares Maß, nicht aber eine generelle Anhalteanordnung gerechtfertigt (ebenda).
Dementsprechend könnte als Rechtsgrundlage für die Maßnahme nur § 31 Abs. 1 Nr. 6 NJVollzG in Betracht kommen. Danach können Schreiben angehalten werden, wenn sie in Geheimschrift, unlesbar, unverständlich oder ohne zwingenden Grund in einer fremden Sprache abgefasst sind. Indes ist keine dieser Voraussetzungen durch das Verwenden von Sütterlinschrift bzw. Deutscher Schreibschrift erfüllt.
Sütterlinschrift ist eine von dem Berliner Grafiker Ludwig Sütterlin um 1911 im Auftrag des preußischen Kulturministeriums geschaffene Schreibschrift. Sie wurde verschiedenen Orts erprobt, leicht abgeändert und war die Grundlage der 1935 an den deutschen Schulen als „Normalschrift“ eingeführten „Deutschen Schreibschrift“. 1941 wurde die „Deutsche Schreibschrift“ durch die „Deutsche Normalschrift“, eine lateinische Schreibschrift, ersetzt. Diese wiederum wurde 1952 durch den „Iserlohner Schreibkreis“ neu gestaltet und in modifizierter Form 1954 von der Kultusministerkonferenz als „Lateinische Ausgangsschrift“ zur Grundlage des Schreibunterrichts in allen Bundesländern gemacht. Parallel dazu wurde - in einigen Bundesländern zum Teil bis in die 1990er Jahre - die Sütterlinschrift als weitere Schriftart zumindest im Leseunterricht an bundesdeutschen Schulen gelehrt (vgl. Brockhaus Enzyklopädie, 19. Aufl.).
Hiernach liegt es zunächst auf der Hand, dass Sütterlinschrift bzw. Deutsche Schreibschrift keine Geheimschrift ist. Auch die Benutzung einer fremden Sprache ist nicht festzustellen. Zwar können Schreiben mittels Sütterlinschrift bzw. Deutscher Schreibschrift auch in einer fremden Sprache abgefasst werden, weil es sich dabei eben nur um Schriftarten handelt. Dass der Antragsteller und seine Verlobte vorliegend eine fremde Sprache benutzen, hat die Antragsgegnerin indes nicht vorgetragen. Das Tatbestandsmerkmal „unverständlich“ knüpft ersichtlich an den Inhalt des Schreibens an und ist deshalb im vorliegenden Fall, in dem es lediglich um die Form des Schreibens geht, ebenfalls nicht einschlägig. Somit verbleibt „unlesbar“ als einzig in Betracht kommendes Tatbestandsmerkmal. Nach welchen Kriterien sich die Lesbarkeit eines Schreibens beurteilt, ist im Gesetz nicht geregelt. Verbindliche Vorschriften darüber, welche Schriftart im Schriftverkehr zu verwenden ist, existieren in Deutschland nicht. Es finden sich nur Regelungen der Bundesländer darüber, welche Schriften im schulischen Schreibunterricht gelehrt werden. Dies sind nach heutigem Stand die Druckschrift als Erstschrift sowie die Lateinische Ausgangsschrift und die Vereinfachte Ausgangsschrift als weitere Schriften (vgl. Bartnitzky in „GS aktuell“ Heft 91/September 2005, 3 ff.). Was hiernach im Allgemeinen als „lesbar“ angesehen wird, ist somit davon abhängig, welche Schriften der Bevölkerungsdurchschnitt in der Schule zu lesen gelernt hat und wie „formklar“ (vgl. Bartnitzky aaO, 10) diese Schrift dann vom jeweiligen Verfasser in der Ausprägung seiner persönlichen Handschrift verwendet wird. Da die Antragsgegnerin allein auf die verwendete Schriftart, nicht auf die persönliche Handschrift des Antragstellers und seiner Verlobten abstellt, ist hier nur jenes Kriterium maßgeblich. Hierzu stellt der Senat als allgemeinkundig fest, dass Sütterlinschrift bzw. Deutsche Schreibschrift zwar schon seit Jahrzehnten nicht mehr Grundlage des Schreibunterrichts an deutschen Schulen sind, diese Schriften aber nach wie vor von weiten Teilen der Bevölkerung zumindest gelesen werden können. Unstreitig sind auch Bedienstete der Antragsgegnerin in der Lage, diese Schriften zu lesen. Dies mag sich in Zukunft ändern, wie auch der Schreibunterricht in den Schulen ständigen Wandlungen unterworfen ist (vgl. Bartnitzky aaO), derzeit ist es aber noch Stand der gesellschaftlichen Entwicklung.
Da hiernach die Verwendung von Sütterlinschrift bzw. Deutscher Schreibschrift keinen Verbotstatbestand des Gesetzes erfüllt, bedurfte der Antragsteller für die Verwendung dieser Schriften auch keiner Erlaubnis.
KlausGraf - am Mittwoch, 19. August 2009, 18:59 - Rubrik: Hilfswissenschaften