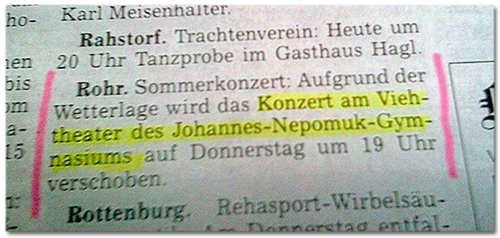Mehrfach ist in der Sekundärliteratur zu lesen, dass Konrad von Hirsau, den ich ja als Peregrinus Hirsaugiensis bezeichne, zwar den 'Accessus ad auctores' und weitere Schriften verfasst habe, aber nicht notwendigerweise auch das 'Speculum virginum' (SV). Unglücklich formulierte im Verfasserlexikon (²5, 1985, Sp. 205) Robert Bultot unter Nr. 1 der Werkliste zum SV, die Verfasserschaft Konrads von Hirsau sei "noch nicht allgemein anerkannt". Richtig ist: Es unterliegt keinem Zweifel, dass alle dort aufgeführten Schriften demselben geistlichen Autor angehören, also auch das SV. Ob man diesen mit einem Hirsauer Benediktiner Konrad identifizieren darf, wird man wohl mit Marco Rainini: Corrado di Hirsau e il "Dialogus de Cruce". Florenz 2014 bejahen dürfen.
Die folgende Zusammenstellung knüpft an frühere Beiträge von mir zum SV an, siehe zuletzt:
https://archiv.twoday.net/stories/1022415045/
Die Überlieferung des "Speculum virginum" wurde von Jutta Seyfarth in ihrer Edition (CCCM 5, 1990) zusammengestellt. Bei der Überprüfung und Ergänzung der Angaben ist es nötig, Vollhandschriften und Exzerpthandschriften voneinander zu trennen und letztere von der Rezeption in eigenständigen Werken. Seyfarth hat dagegen 5 Gruppen gebildet (S. 56*-123*):
I. Lateinische Handschriften, die dem Stemma zugrundeliegen (10)
II. Lateinische Handschriften, die dem Stemma eingeordnet sind (19)
III. Auszüge, Fragmente, Nachrichten über verschollene Handschriften (7)
IV. Handschriften mittelniederländischer, bzw. volkssprachlicher Übersetzungen (26)
V. Druckausgaben (2)
IV und V habe ich bereits bearbeitet, zu III habe ich schon Hinweise zu einzelnen Textzeugen publiziert. Gruppe I besteht nur aus Vollhandschriften (auch wenn im Einzelnen Textverlust vorliegt), während aus Gruppe II (19 Handschriften) fünf Handschriften (E, Fl = St. Florian CSF XI, 370, Me = Melk 2, Pe, Re= Reims 611) als Exzerpt-Überlieferung zu entfernen sind. E und Pe überliefern einen eigenständigen Text als Ableitung des SV, "De proprietate vitiorum et virtutum", für den ich zwei weitere Handschriften nachweisen konnte in:
https://archiv.twoday.net/stories/1022415045/
Von den 24 Vollhandschriften wies Matthäus Bernards bereits 23 nach. Seyfarth konnte nur C2 = Leipzig, UB, Ms. 666 beibringen. Eine bisher unbekannte Vollhandschrift ist mir noch nicht begegnet, Neufunde habe ich nur für die noch ausstehende Gruppe der Fragmente, Exzerpte und Nennungen in Bibliothekskatalogen o.ä.
Die Handschriftenliste ist ein einfacher Census, geordnet nach dem Alter der Handschriften. Hinter der Signatur stehen das Siglum bei Seyfarth und die Seitenzahl(en) ihrer Beschreibung. Signaturen von Einzelblättern werden nicht angegeben (das betrifft K und M). Verlinkt sind vor allem Digitalisate und Katalogeinträge. Angegeben ist die Datierung - in der Regel nach nach Seyfarth, deren paläographische Datierungen noch der Überprüfung harren (siehe ihre Fehldatierungen zu den beiden Leipziger Handschriften) - und die Provenienz.
Zu den Bildern muss auf die Angaben bei Seyfarth S. 133* und 137* und bei den jeweiligen Handschriften verwiesen werden. Zu den Handschriften der Gruppe I gibt es S. 134* eine Tabelle zu den genauen Blattangaben der 12 großen Bilder, die Seyfarth wie folgt benennt:
1: Wurzel Jesse
2: Mystisches Paradies
3: Lasterbaum
4: Tugendbaum
5: Humilitas-Superbia
6: Quadriga
7: Kluge und Törichte Jungfrauen
8: Drei Grade
9: Fleisch und Geist
10: Aufstieg auf der Leiter
11: Maiestas domini
12: Weisheitstempel
Außerdem gibt es kleine Autorenbilder von Peregrinus und Theodora sowie Handzeichen für die drei Stände. Bild 11 zeigt den Autor vor dem Weltenherrscher.
Komplette Bebilderung registrierte Seyfarth für: L, K, T 1, B, Z (aus Gruppe 1), D1, D2 (aus Gruppe 2). Raum für nicht ausgeführte Bilder war vorgesehen in: W, A2, Dü, P. Ganz ohne den Bilder-Zyklus blieben nur F und O, aber selbst diese Handschriften sind mit je einer Federzeichnung illustriert.
Der Bilderzyklus wurde also von den Schreibern als wichtige Beigabe zum Text aufgefasst, der in den meisten Handschriften wenigstens in lückenhafter Form erhalten blieb.
Vollhandschriften des Speculum virginum
[1] London, BL, Arundel 44 (L, S. 56*-60), 1140/50, aus Eberbach OCist
Beschreibung und Bilder:
https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=7952&CollID=20&NStart=44
[2] Köln, HA, W 276a (K, S. 60*-63), Mitte 12. Jahrhundert, wahrscheinlich aus dem Augustinerchorfrauenstift St. Maria in Andernach
Digitalisat (SW-Mikrofilm)
https://historischesarchivkoeln.de/de_DE/dokument/1618872/Best.+7010+276A+
Joachim Vennebusch 1986
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0089_b157_jpg.htm
Zur Beziehung zu Maria Laach OSB
https://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/41/93
[3] Rom, BV, Pal. lat. 565 (V, S. 63*-65*), um 1155, aus dem Augustinerchorherrenstift Frankenthal
Digitalisat
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_565
[4] Trier, Bistumsarchiv, 95/132 (M, S. 71*-75*), um 1200, aus St. Matthias in Trier OSB
Digitalisat
https://stmatthias.uni-trier.de/ bzw.
https://dfg-viewer.de/show/?set[mets]=http%3A%2F%2Fzimks68.uni-trier.de%2Fstmatthias%2FTBA0132%2FTBA0132-digitalisat.xml
Petrus Becker 1996
https://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/44/133
[5] Würzburg, UB, M.p.th. f. 107 (W, S. 76*f.), Ende 12./Anfang 13. Jh., aus Ebrach OCist
Hans Thurn 1970
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0082_b030_jpg.htm
Siehe auch den Katalog der Pergamenthandschriften in Ebrach von 1789:
https://hdl.handle.net/2027/nyp.33433069121923?urlappend=%3Bseq=192
[6] Troyes, BM, 413 (T2, S. 67*f.), Anfang 13. Jahrhundert, Skriptorium: Clairvaux (?), aus Mores OCist
Bilder (mit Datierung 1. Viertel 13. Jahrhundert):
https://initiale.irht.cnrs.fr/ouvrages/ouvrages.php?imageInd=1&id=4767
[7] Berlin, SB, Phill. 1701 (B, S. 68*f.), Anfang 13. Jahrhundert, aus Igny OCist
Valentin Rose 1893
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0709_c0133_jpg.htm (mit Wiedergabe des Widmungsbriefs und Erörterungen zum Verfasser)
Joachim Kirchner 1926
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0599_b0064_jpg.htm
Haenel 1830 schreibt das Speculum virginum der damals in Middlehill befindlichen Handschrift Hugo von Folieto zu. Damit ist mindestens einer der “alii” gefunden, denen der Katalog der Arundel-Handschriften 1840 diese Verfasserangabe zuweist, siehe Seyfarths Einleitung S. 50*.
https://hdl.handle.net/2027/nyp.33433069136749?urlappend=%3Bseq=452
So aber schon zur gleichen Handschrift ein Katalog 1769
https://books.google.de/books?id=Gk8VAAAAQAAJ&pg=PT111
[8] Zwettl, Zisterzienserstift, 180 (Z, S. 75*f.), 1. Drittel 13. Jh., aus Zwettl OCist
https://manuscripta.at/?ID=31791 (Peregrinus de Oppeln!)
https://wwwg.uni-klu.ac.at/kultdoku/kataloge/16/html/1338.htm (1. V. 13. Jh.)
Abschrift (18. Jh.) im Nachlass der Brüder Pez
Melk, Benediktinerstift, 395, S. 223-517
Digitalisat der Abschrift:
https://unidam.univie.ac.at/id/448686
[9] Baltimore, Walters Art Gallery, W 72 (H, S. 70*f.), Anfang bis Mitte 13. Jahrhundert, aus Himmerod OCist
Digitalisat
https://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/html/W72/description.html (1. Viertel 13. Jahrhundert)
[10] Leipzig, UB, 665 (C1, S. 82*f.), 3. Viertel 13. Jahrhundert (Seyfarth: Mitte 14. Jahrhundert)
Die Datierung aus der Beschreibung von Anette Löffler 2002, die mir die UB Leipzig freundlicherweise zur Verfügung stellte. Löffler: "Bislang vermutete Provenienz aus Altzelle nicht aufrechtzuerhalten (z.B. Fehlen der charakteristischen Besitzvermerke, kein Nachweis im Altzeller Bibliothekskatalog von 1514: das dort unter Pulp. O, Nr. 10 vermerkte SV ist Ms 820: Conradus de Saxonia, Speculum beatae Mariae virginis). Aufgrund Schrift und Illumination Entstehung in Mitteldeutschland wahrscheinlich; Schriftähnlichkeiten mit dem Landgrafenpsalter lassen an eine Entstehung in derselben Schreibschule denken." (Altzelle OCist!)
Robert Bruck 1906
https://archive.org/stream/diemalereieninde00bruc#page/232/mode/2up
[11] Leipzig, UB, 666 (C2, S. 83*-85*), 4. Viertel 13. Jahrhundert (Seyfarth: 1. Hälfte 14. Jahrhundert), aus Chemnitz OSB (Löffler: "Ms stammt aus dem Benediktinerkloster Chemnitz, vgl. radierter Besitzvermerk des 13. Jhs. (nur sehr schwer unter UV-Lampe erkennbar) auf 1v: Iste liber est sancte Marie uirginis et sancti Benedicti confessoris in Kemnicz").
[12] Arras, BM, 282 (A1, S. 78*f.), 2. Hälfte 13. Jahrhundert, aus St. Vedastus in Arras OSB
Catalogue général 1872
https://books.google.de/books?id=HYBWAAAAcAAJ&pg=PA374
[13] Troyes, BM, 252 (T1, S. 65*f), um 1300, aus Clairvaux OCist
Bilder:
https://www.enluminures.culture.fr/public/mistral/enlumine_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=REFD&VALUE_98='Troyes%20-%20BM%20-%20ms.%200252'&DOM=All
https://bvmm.irht.cnrs.fr/consult/consult.php?reproductionId=6755
Digitalisat (kaum benutzbar):
https://www.bibliotheque-virtuelle-clairvaux.com/manuscrits/
Die Handschrift war bereits online laut
https://www.univ-nancy2.fr/MOYENAGE/UREEF/MUSICOLOGIE/CMN/FT.htm
[14] Prag, Metropolitankapitel, N 23 (P, S. 98*f.), Mitte 14. Jahrhundert, aus dem Augustinerchorherrenstift Glatz
Anton Podlaha 1922
https://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=36&bookid=367&page=405
[15] Mainz, StadtB, II 173 (F, S. 90*-92*), 1. Viertel 15. Jahrhundert
Abbildung der Federzeichnung Bl. 256v:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aus_dem_Haupt_Christi_erwachsen_die_sieben_Geistesgaben.jpg
[16] Burgsteinfurt, SchlossB bzw. Bentheim’sches Archiv, C 35 (S, S. 101*f.), 1430, aus dem Augustinerchorherrenstift Frenswegen
Signatur (Seyfarth: Cod. 4) nach Irene Stahl 1994
https://books.google.de/books?id=7K_1EoPIYtoC&pg=PA41
[17] Burgo de Osma, Kathedralbibliothek, 53 (Bu, S. 81*), 1434, geschrieben wahrscheinlich in Spanien
Timoteo Rojo Orcajo 1929
https://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10068716
[18] Innsbruck, UB, 742 (I, S. 94*f.), 1437, geschrieben von “Johannes de Aschaff rector Odernhemensis ecclesie” (Gau-Odernheim), Frankfurter (?) Einband
https://manuscripta.at/?ID=29414
[19] Darmstadt, ULB, 529 (D1, S. 85*f.), Westdeutschland (?), um 1460
Kurt Hans Staub 1979
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0015_a144_JPG.htm
[20] München, SB, Clm 3561 (O, S. 96*-98*), 1461 von Sigismund Gossembrots Hand, der auch einen Teil des Speculum virginum schrieb, Niederschrift in Augsburg
Erwin Rauner
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31722731
Rehm 1994
https://bookview.libreka.de/bookviewer/9783873204287/151
Digitalisat (SW):
https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00103127/image_9
[21] Darmstadt, ULB, 738 (D2, S. 86*f.), Ende 15. Jahrhundert, aus dem Birgittenkloster Sion in Köln
Kurt Hans Staub 1979
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0015_a172_JPG.htm
Die in diesem Kloster lebenden Zisterzienserinnen nannten ihr Kloster im Mittelalter auch Speculum virginum!
[22] Düsseldorf, ULB, B 124 (Dü, S. 87*f.), dieser Teil um 1500, aus dem Kreuzherrenkloster Düsseldorf
Digitalisat:
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/man/content/titleinfo/6271196 (mit Link zum Eintrag im gedruckten Katalog von Agata Mazurek und Joachim Ott 2011)
-
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31181180
[23] Köln, HA, GB 2° 155 (G, S. 93*f.), um 1520, aus dem Kreuzherrenkloster Köln
Joachim Vennebusch 1976
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0037_b127_JPG.htm
Digitalisat (SW-Mikrofilm)
https://historischesarchivkoeln.de/de/lesesaal/verzeichnungseinheit/171982/Best.+7002+155
[24] Arras, BM 916 (A2, S. 79*f.), 1628 aus St. Vedastus in Arras OSB, Abschrift von A1
Catalogue général 1872
https://books.google.de/books?id=HYBWAAAAcAAJ&pg=PA281
Auswertung
Komplettdigitalisate gibt es für acht der 24 Vollhandschriften. Zu Leipzig 665 ist ein Digitalisat angekündigt.
Aus der Zeit vor 1200 stammen die ersten drei Handschriften, vielleicht auch Nr. 4. Seyfarth hat sich dagegen entschieden, in der Londoner Handschrift L ein Autograph des Verfassers zu sehen. Das wurde in der Forschung akzeptiert, aber nicht kritisch überprüft. Felix Heinzer hat seine Vermutung, es handle sich bei L um ein Produkt des Hirsauer Skriptoriums, zurückgezogen.
Dreizehn Handschriften sind bis ca. 1300 entstanden, eine stammt aus dem 14. Jahrhundert. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurden vier Handschriften geschrieben, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und bis ca. 1520 fünf. Eine späte Abschrift entstand 1628.
Die Wiederentdeckung des Textes im 15. Jahrhunderts stand im Zeichen der "devotio moderna". Siehe auch
https://archiv.twoday.net/stories/1022385921/
Die heute in Burgsteinfurt befindliche Handschrift entstand im Stift Frenswegen der Windesheimer Chorherren. Aus dem Köln-Düsseldorfer Raum stammen von diesen fünf späten Handschriften drei. Eine schrieb Sigismund Gossembrot
https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=103086838
in Augsburg. Dem Stemma bei Seyfarth S. 130* zufolge gehört seine Handschrift zu einer Gruppe mit Innsbruck (I) und Mainz (F) - sie gehen auf H zurück. Ebenso stehen sich D2 (Köln) und Dü (Kreuzherren Düsseldorf) nahe, während D1 mit C1 und C2 zu einer ganz anderen Handschriftengruppe gehört. Zu wieder einer anderen Gruppe gehört das aus dem Kölner Kreuzherrenkloster stammende G (Ableitung von K). Es ist aber sicher kein Zufall, dass die wichtige Textsammlung zu Peregrinus Hirsaugiensis/Konrad von Hirsau im Kölner Cod. GB 4° 206
https://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1515357/Best.+7004%2B206%2B
(sie entspricht in etwa dem Eberbacher "Peregrinus minor") ebenfalls im Kreuzherrenkloster zu Köln entstand.
Von den bis ca. 1300 zu datierenden Handschriften sind fünf rheinländischer Provenienz, vier stammen aus Frankreich, zwei aus Sachsen/Mitteldeutschland und je eine aus Franken (Ebrach) und Österreich (Zwettl). Man muss allerdings beachten, dass bei diesen frühen Handschriften fast nie der Schreibort sicher feststeht. Gesichert ist für V das Skriptorium von Frankenthal. Bei T1 und T2 hat Goggin Niederschrift in Clairvaux vermutet.
Die Handschriften des 15./16. Jahrhunderts gehören überwiegend dem westdeutschen Raum an, was wieder auf die devotio moderna verweist. Der einzige Ausreißer (Gossembrot in Augsburg) ist aber eine Ableitung der Himmeroder Handschrift H.
Bei den ältesten Handschriften stellt sich natürlich die Frage, ob der heutige Überlieferungsbefund Schlüsse auf die Entstehung des Werks zulässt. Die erhaltenen Textzeugen bis ca. 1300 stammen nicht aus hirsauischen Klöstern (sieht man von Chemnitz ab) und auch nicht aus Schwaben. Es dominieren eindeutig die Zisterzienser und der mittelrheinische Raum. Dies muss aber keineswegs den Entstehungskontext bezeichnen. Bei den anderen Werken des Peregrinus sind die benediktinischen Bezüge deutlicher.
Dass K in Andernach entstanden ist (und auch das Werk, wie die italienische Wikipedia suggeriert:
Speculum virginum. (9 maggio 2015). Wikipedia, L'enciclopedia libera. Tratto il 15 settembre 2015, 00:11 da https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Speculum_virginum&oldid=72687933 ) ist alles andere als gesichert. Unterschlagen werden die deutlichen Hinweise auf das benediktinische Kloster Laach (siehe oben).
Wie voreingenommen Bernards 1951 die Frage anging, kann man dem Digitalisat
https://www.dilibri.de/rlb/periodical/pageview/219432
entnehmen. Seyfarth hat sich Bernards Ansichten angeschlossen und die Augustinerchorherren favorisiert. Glücklicherweise kam es mit den Arbeiten von Mews und dann von Rainini zu einer Rückkehr zu "Konrad von Hirsau". Die Aussage der Texte des Peregrinus-Korpus verweist auf einen Mönch als Autor, nicht auf einen Regularkanoniker, und im SV VIII Zeile 760 wird Benedikt als sanctus pastor noster angesprochen, dessen Regel für die Dialogpartnerin Theodora verbindlich ist (vgl. ²VL 9, Sp. 69).
Die Verbreitung der frühesten Handschriften legt eine Entstehung des SV im benediktinischen Kontext gewiss nicht nahe, sie schließt sie aber auch nicht aus. Vermutlich haben im 12. Jahrhundert Zisterzienser (die älteste Handschrift gehört provenienzmäßig nach Eberbach OCist!), Augustinerchorherren und Benediktiner bei der Verbreitung des SV eng zusammengearbeitet. Im 13. Jahrhundert scheinen vor allem die Zisterzienser Gefallen an dem Werk gefunden zu haben, wie auch die frühe Rezeption bei Abt Adam von Perseigne (ca. 1180/1220) zeigt:
https://ordensgeschichte.hypotheses.org/5570
#forschung
 Zeichnung in der Mainzer Handschrift
Zeichnung in der Mainzer Handschrift
Die folgende Zusammenstellung knüpft an frühere Beiträge von mir zum SV an, siehe zuletzt:
https://archiv.twoday.net/stories/1022415045/
Die Überlieferung des "Speculum virginum" wurde von Jutta Seyfarth in ihrer Edition (CCCM 5, 1990) zusammengestellt. Bei der Überprüfung und Ergänzung der Angaben ist es nötig, Vollhandschriften und Exzerpthandschriften voneinander zu trennen und letztere von der Rezeption in eigenständigen Werken. Seyfarth hat dagegen 5 Gruppen gebildet (S. 56*-123*):
I. Lateinische Handschriften, die dem Stemma zugrundeliegen (10)
II. Lateinische Handschriften, die dem Stemma eingeordnet sind (19)
III. Auszüge, Fragmente, Nachrichten über verschollene Handschriften (7)
IV. Handschriften mittelniederländischer, bzw. volkssprachlicher Übersetzungen (26)
V. Druckausgaben (2)
IV und V habe ich bereits bearbeitet, zu III habe ich schon Hinweise zu einzelnen Textzeugen publiziert. Gruppe I besteht nur aus Vollhandschriften (auch wenn im Einzelnen Textverlust vorliegt), während aus Gruppe II (19 Handschriften) fünf Handschriften (E, Fl = St. Florian CSF XI, 370, Me = Melk 2, Pe, Re= Reims 611) als Exzerpt-Überlieferung zu entfernen sind. E und Pe überliefern einen eigenständigen Text als Ableitung des SV, "De proprietate vitiorum et virtutum", für den ich zwei weitere Handschriften nachweisen konnte in:
https://archiv.twoday.net/stories/1022415045/
Von den 24 Vollhandschriften wies Matthäus Bernards bereits 23 nach. Seyfarth konnte nur C2 = Leipzig, UB, Ms. 666 beibringen. Eine bisher unbekannte Vollhandschrift ist mir noch nicht begegnet, Neufunde habe ich nur für die noch ausstehende Gruppe der Fragmente, Exzerpte und Nennungen in Bibliothekskatalogen o.ä.
Die Handschriftenliste ist ein einfacher Census, geordnet nach dem Alter der Handschriften. Hinter der Signatur stehen das Siglum bei Seyfarth und die Seitenzahl(en) ihrer Beschreibung. Signaturen von Einzelblättern werden nicht angegeben (das betrifft K und M). Verlinkt sind vor allem Digitalisate und Katalogeinträge. Angegeben ist die Datierung - in der Regel nach nach Seyfarth, deren paläographische Datierungen noch der Überprüfung harren (siehe ihre Fehldatierungen zu den beiden Leipziger Handschriften) - und die Provenienz.
Zu den Bildern muss auf die Angaben bei Seyfarth S. 133* und 137* und bei den jeweiligen Handschriften verwiesen werden. Zu den Handschriften der Gruppe I gibt es S. 134* eine Tabelle zu den genauen Blattangaben der 12 großen Bilder, die Seyfarth wie folgt benennt:
1: Wurzel Jesse
2: Mystisches Paradies
3: Lasterbaum
4: Tugendbaum
5: Humilitas-Superbia
6: Quadriga
7: Kluge und Törichte Jungfrauen
8: Drei Grade
9: Fleisch und Geist
10: Aufstieg auf der Leiter
11: Maiestas domini
12: Weisheitstempel
Außerdem gibt es kleine Autorenbilder von Peregrinus und Theodora sowie Handzeichen für die drei Stände. Bild 11 zeigt den Autor vor dem Weltenherrscher.
Komplette Bebilderung registrierte Seyfarth für: L, K, T 1, B, Z (aus Gruppe 1), D1, D2 (aus Gruppe 2). Raum für nicht ausgeführte Bilder war vorgesehen in: W, A2, Dü, P. Ganz ohne den Bilder-Zyklus blieben nur F und O, aber selbst diese Handschriften sind mit je einer Federzeichnung illustriert.
Der Bilderzyklus wurde also von den Schreibern als wichtige Beigabe zum Text aufgefasst, der in den meisten Handschriften wenigstens in lückenhafter Form erhalten blieb.
Vollhandschriften des Speculum virginum
[1] London, BL, Arundel 44 (L, S. 56*-60), 1140/50, aus Eberbach OCist
Beschreibung und Bilder:
https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=7952&CollID=20&NStart=44
[2] Köln, HA, W 276a (K, S. 60*-63), Mitte 12. Jahrhundert, wahrscheinlich aus dem Augustinerchorfrauenstift St. Maria in Andernach
Digitalisat (SW-Mikrofilm)
https://historischesarchivkoeln.de/de_DE/dokument/1618872/Best.+7010+276A+
Joachim Vennebusch 1986
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0089_b157_jpg.htm
Zur Beziehung zu Maria Laach OSB
https://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/41/93
[3] Rom, BV, Pal. lat. 565 (V, S. 63*-65*), um 1155, aus dem Augustinerchorherrenstift Frankenthal
Digitalisat
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_565
[4] Trier, Bistumsarchiv, 95/132 (M, S. 71*-75*), um 1200, aus St. Matthias in Trier OSB
Digitalisat
https://stmatthias.uni-trier.de/ bzw.
https://dfg-viewer.de/show/?set[mets]=http%3A%2F%2Fzimks68.uni-trier.de%2Fstmatthias%2FTBA0132%2FTBA0132-digitalisat.xml
Petrus Becker 1996
https://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/44/133
[5] Würzburg, UB, M.p.th. f. 107 (W, S. 76*f.), Ende 12./Anfang 13. Jh., aus Ebrach OCist
Hans Thurn 1970
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0082_b030_jpg.htm
Siehe auch den Katalog der Pergamenthandschriften in Ebrach von 1789:
https://hdl.handle.net/2027/nyp.33433069121923?urlappend=%3Bseq=192
[6] Troyes, BM, 413 (T2, S. 67*f.), Anfang 13. Jahrhundert, Skriptorium: Clairvaux (?), aus Mores OCist
Bilder (mit Datierung 1. Viertel 13. Jahrhundert):
https://initiale.irht.cnrs.fr/ouvrages/ouvrages.php?imageInd=1&id=4767
[7] Berlin, SB, Phill. 1701 (B, S. 68*f.), Anfang 13. Jahrhundert, aus Igny OCist
Valentin Rose 1893
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0709_c0133_jpg.htm (mit Wiedergabe des Widmungsbriefs und Erörterungen zum Verfasser)
Joachim Kirchner 1926
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0599_b0064_jpg.htm
Haenel 1830 schreibt das Speculum virginum der damals in Middlehill befindlichen Handschrift Hugo von Folieto zu. Damit ist mindestens einer der “alii” gefunden, denen der Katalog der Arundel-Handschriften 1840 diese Verfasserangabe zuweist, siehe Seyfarths Einleitung S. 50*.
https://hdl.handle.net/2027/nyp.33433069136749?urlappend=%3Bseq=452
So aber schon zur gleichen Handschrift ein Katalog 1769
https://books.google.de/books?id=Gk8VAAAAQAAJ&pg=PT111
[8] Zwettl, Zisterzienserstift, 180 (Z, S. 75*f.), 1. Drittel 13. Jh., aus Zwettl OCist
https://manuscripta.at/?ID=31791 (Peregrinus de Oppeln!)
https://wwwg.uni-klu.ac.at/kultdoku/kataloge/16/html/1338.htm (1. V. 13. Jh.)
Abschrift (18. Jh.) im Nachlass der Brüder Pez
Melk, Benediktinerstift, 395, S. 223-517
Digitalisat der Abschrift:
https://unidam.univie.ac.at/id/448686
[9] Baltimore, Walters Art Gallery, W 72 (H, S. 70*f.), Anfang bis Mitte 13. Jahrhundert, aus Himmerod OCist
Digitalisat
https://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/html/W72/description.html (1. Viertel 13. Jahrhundert)
[10] Leipzig, UB, 665 (C1, S. 82*f.), 3. Viertel 13. Jahrhundert (Seyfarth: Mitte 14. Jahrhundert)
Die Datierung aus der Beschreibung von Anette Löffler 2002, die mir die UB Leipzig freundlicherweise zur Verfügung stellte. Löffler: "Bislang vermutete Provenienz aus Altzelle nicht aufrechtzuerhalten (z.B. Fehlen der charakteristischen Besitzvermerke, kein Nachweis im Altzeller Bibliothekskatalog von 1514: das dort unter Pulp. O, Nr. 10 vermerkte SV ist Ms 820: Conradus de Saxonia, Speculum beatae Mariae virginis). Aufgrund Schrift und Illumination Entstehung in Mitteldeutschland wahrscheinlich; Schriftähnlichkeiten mit dem Landgrafenpsalter lassen an eine Entstehung in derselben Schreibschule denken." (Altzelle OCist!)
Robert Bruck 1906
https://archive.org/stream/diemalereieninde00bruc#page/232/mode/2up
[11] Leipzig, UB, 666 (C2, S. 83*-85*), 4. Viertel 13. Jahrhundert (Seyfarth: 1. Hälfte 14. Jahrhundert), aus Chemnitz OSB (Löffler: "Ms stammt aus dem Benediktinerkloster Chemnitz, vgl. radierter Besitzvermerk des 13. Jhs. (nur sehr schwer unter UV-Lampe erkennbar) auf 1v: Iste liber est sancte Marie uirginis et sancti Benedicti confessoris in Kemnicz").
[12] Arras, BM, 282 (A1, S. 78*f.), 2. Hälfte 13. Jahrhundert, aus St. Vedastus in Arras OSB
Catalogue général 1872
https://books.google.de/books?id=HYBWAAAAcAAJ&pg=PA374
[13] Troyes, BM, 252 (T1, S. 65*f), um 1300, aus Clairvaux OCist
Bilder:
https://www.enluminures.culture.fr/public/mistral/enlumine_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=REFD&VALUE_98='Troyes%20-%20BM%20-%20ms.%200252'&DOM=All
https://bvmm.irht.cnrs.fr/consult/consult.php?reproductionId=6755
Digitalisat (kaum benutzbar):
https://www.bibliotheque-virtuelle-clairvaux.com/manuscrits/
Die Handschrift war bereits online laut
https://www.univ-nancy2.fr/MOYENAGE/UREEF/MUSICOLOGIE/CMN/FT.htm
[14] Prag, Metropolitankapitel, N 23 (P, S. 98*f.), Mitte 14. Jahrhundert, aus dem Augustinerchorherrenstift Glatz
Anton Podlaha 1922
https://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=36&bookid=367&page=405
[15] Mainz, StadtB, II 173 (F, S. 90*-92*), 1. Viertel 15. Jahrhundert
Abbildung der Federzeichnung Bl. 256v:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aus_dem_Haupt_Christi_erwachsen_die_sieben_Geistesgaben.jpg
[16] Burgsteinfurt, SchlossB bzw. Bentheim’sches Archiv, C 35 (S, S. 101*f.), 1430, aus dem Augustinerchorherrenstift Frenswegen
Signatur (Seyfarth: Cod. 4) nach Irene Stahl 1994
https://books.google.de/books?id=7K_1EoPIYtoC&pg=PA41
[17] Burgo de Osma, Kathedralbibliothek, 53 (Bu, S. 81*), 1434, geschrieben wahrscheinlich in Spanien
Timoteo Rojo Orcajo 1929
https://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10068716
[18] Innsbruck, UB, 742 (I, S. 94*f.), 1437, geschrieben von “Johannes de Aschaff rector Odernhemensis ecclesie” (Gau-Odernheim), Frankfurter (?) Einband
https://manuscripta.at/?ID=29414
[19] Darmstadt, ULB, 529 (D1, S. 85*f.), Westdeutschland (?), um 1460
Kurt Hans Staub 1979
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0015_a144_JPG.htm
[20] München, SB, Clm 3561 (O, S. 96*-98*), 1461 von Sigismund Gossembrots Hand, der auch einen Teil des Speculum virginum schrieb, Niederschrift in Augsburg
Erwin Rauner
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31722731
Rehm 1994
https://bookview.libreka.de/bookviewer/9783873204287/151
Digitalisat (SW):
https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00103127/image_9
[21] Darmstadt, ULB, 738 (D2, S. 86*f.), Ende 15. Jahrhundert, aus dem Birgittenkloster Sion in Köln
Kurt Hans Staub 1979
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0015_a172_JPG.htm
Die in diesem Kloster lebenden Zisterzienserinnen nannten ihr Kloster im Mittelalter auch Speculum virginum!
[22] Düsseldorf, ULB, B 124 (Dü, S. 87*f.), dieser Teil um 1500, aus dem Kreuzherrenkloster Düsseldorf
Digitalisat:
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/man/content/titleinfo/6271196 (mit Link zum Eintrag im gedruckten Katalog von Agata Mazurek und Joachim Ott 2011)
-
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31181180
[23] Köln, HA, GB 2° 155 (G, S. 93*f.), um 1520, aus dem Kreuzherrenkloster Köln
Joachim Vennebusch 1976
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0037_b127_JPG.htm
Digitalisat (SW-Mikrofilm)
https://historischesarchivkoeln.de/de/lesesaal/verzeichnungseinheit/171982/Best.+7002+155
[24] Arras, BM 916 (A2, S. 79*f.), 1628 aus St. Vedastus in Arras OSB, Abschrift von A1
Catalogue général 1872
https://books.google.de/books?id=HYBWAAAAcAAJ&pg=PA281
Auswertung
Komplettdigitalisate gibt es für acht der 24 Vollhandschriften. Zu Leipzig 665 ist ein Digitalisat angekündigt.
Aus der Zeit vor 1200 stammen die ersten drei Handschriften, vielleicht auch Nr. 4. Seyfarth hat sich dagegen entschieden, in der Londoner Handschrift L ein Autograph des Verfassers zu sehen. Das wurde in der Forschung akzeptiert, aber nicht kritisch überprüft. Felix Heinzer hat seine Vermutung, es handle sich bei L um ein Produkt des Hirsauer Skriptoriums, zurückgezogen.
Dreizehn Handschriften sind bis ca. 1300 entstanden, eine stammt aus dem 14. Jahrhundert. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurden vier Handschriften geschrieben, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und bis ca. 1520 fünf. Eine späte Abschrift entstand 1628.
Die Wiederentdeckung des Textes im 15. Jahrhunderts stand im Zeichen der "devotio moderna". Siehe auch
https://archiv.twoday.net/stories/1022385921/
Die heute in Burgsteinfurt befindliche Handschrift entstand im Stift Frenswegen der Windesheimer Chorherren. Aus dem Köln-Düsseldorfer Raum stammen von diesen fünf späten Handschriften drei. Eine schrieb Sigismund Gossembrot
https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=103086838
in Augsburg. Dem Stemma bei Seyfarth S. 130* zufolge gehört seine Handschrift zu einer Gruppe mit Innsbruck (I) und Mainz (F) - sie gehen auf H zurück. Ebenso stehen sich D2 (Köln) und Dü (Kreuzherren Düsseldorf) nahe, während D1 mit C1 und C2 zu einer ganz anderen Handschriftengruppe gehört. Zu wieder einer anderen Gruppe gehört das aus dem Kölner Kreuzherrenkloster stammende G (Ableitung von K). Es ist aber sicher kein Zufall, dass die wichtige Textsammlung zu Peregrinus Hirsaugiensis/Konrad von Hirsau im Kölner Cod. GB 4° 206
https://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1515357/Best.+7004%2B206%2B
(sie entspricht in etwa dem Eberbacher "Peregrinus minor") ebenfalls im Kreuzherrenkloster zu Köln entstand.
Von den bis ca. 1300 zu datierenden Handschriften sind fünf rheinländischer Provenienz, vier stammen aus Frankreich, zwei aus Sachsen/Mitteldeutschland und je eine aus Franken (Ebrach) und Österreich (Zwettl). Man muss allerdings beachten, dass bei diesen frühen Handschriften fast nie der Schreibort sicher feststeht. Gesichert ist für V das Skriptorium von Frankenthal. Bei T1 und T2 hat Goggin Niederschrift in Clairvaux vermutet.
Die Handschriften des 15./16. Jahrhunderts gehören überwiegend dem westdeutschen Raum an, was wieder auf die devotio moderna verweist. Der einzige Ausreißer (Gossembrot in Augsburg) ist aber eine Ableitung der Himmeroder Handschrift H.
Bei den ältesten Handschriften stellt sich natürlich die Frage, ob der heutige Überlieferungsbefund Schlüsse auf die Entstehung des Werks zulässt. Die erhaltenen Textzeugen bis ca. 1300 stammen nicht aus hirsauischen Klöstern (sieht man von Chemnitz ab) und auch nicht aus Schwaben. Es dominieren eindeutig die Zisterzienser und der mittelrheinische Raum. Dies muss aber keineswegs den Entstehungskontext bezeichnen. Bei den anderen Werken des Peregrinus sind die benediktinischen Bezüge deutlicher.
Dass K in Andernach entstanden ist (und auch das Werk, wie die italienische Wikipedia suggeriert:
Speculum virginum. (9 maggio 2015). Wikipedia, L'enciclopedia libera. Tratto il 15 settembre 2015, 00:11 da https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Speculum_virginum&oldid=72687933 ) ist alles andere als gesichert. Unterschlagen werden die deutlichen Hinweise auf das benediktinische Kloster Laach (siehe oben).
Wie voreingenommen Bernards 1951 die Frage anging, kann man dem Digitalisat
https://www.dilibri.de/rlb/periodical/pageview/219432
entnehmen. Seyfarth hat sich Bernards Ansichten angeschlossen und die Augustinerchorherren favorisiert. Glücklicherweise kam es mit den Arbeiten von Mews und dann von Rainini zu einer Rückkehr zu "Konrad von Hirsau". Die Aussage der Texte des Peregrinus-Korpus verweist auf einen Mönch als Autor, nicht auf einen Regularkanoniker, und im SV VIII Zeile 760 wird Benedikt als sanctus pastor noster angesprochen, dessen Regel für die Dialogpartnerin Theodora verbindlich ist (vgl. ²VL 9, Sp. 69).
Die Verbreitung der frühesten Handschriften legt eine Entstehung des SV im benediktinischen Kontext gewiss nicht nahe, sie schließt sie aber auch nicht aus. Vermutlich haben im 12. Jahrhundert Zisterzienser (die älteste Handschrift gehört provenienzmäßig nach Eberbach OCist!), Augustinerchorherren und Benediktiner bei der Verbreitung des SV eng zusammengearbeitet. Im 13. Jahrhundert scheinen vor allem die Zisterzienser Gefallen an dem Werk gefunden zu haben, wie auch die frühe Rezeption bei Abt Adam von Perseigne (ca. 1180/1220) zeigt:
https://ordensgeschichte.hypotheses.org/5570
#forschung
 Zeichnung in der Mainzer Handschrift
Zeichnung in der Mainzer HandschriftKlausGraf - am Montag, 14. September 2015, 23:25 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2015/3571
Auswertung der Quellen zur Geschichte und Kunstgeschichte der Martinskirche in Kornwestheim auf dem Forschungsstand von 1989. Zur Geschichte dieser Publikation siehe
https://archiv.twoday.net/stories/313117659/
Auswertung der Quellen zur Geschichte und Kunstgeschichte der Martinskirche in Kornwestheim auf dem Forschungsstand von 1989. Zur Geschichte dieser Publikation siehe
https://archiv.twoday.net/stories/313117659/
KlausGraf - am Montag, 14. September 2015, 18:18 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Peter Murray Rust sagt nein:
https://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2015/09/14/should-wikipedia-work-with-elsevier/
https://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2015/09/14/should-wikipedia-work-with-elsevier/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://staatsarchiv.lu.ch/schaufenster/quellen/Soldaten
Aus dem neuen Computergenealogie Newsletter
https://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2015/09

Aus dem neuen Computergenealogie Newsletter
https://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2015/09

KlausGraf - am Montag, 14. September 2015, 15:26 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 14. September 2015, 15:19 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 14. September 2015, 15:17 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://dx.doi.org/10.7554/eLife.09560
Der Artikel über den Sensations-Fund von Frühmenschen in Südafrika erschien im Open-Access-Journal eLife.
Update:
https://infobib.de/2015/09/16/homo-naledi-entdeckung-ist-oa-und-wird-sogar-verlinkt/
Der Artikel über den Sensations-Fund von Frühmenschen in Südafrika erschien im Open-Access-Journal eLife.
Update:
https://infobib.de/2015/09/16/homo-naledi-entdeckung-ist-oa-und-wird-sogar-verlinkt/
KlausGraf - am Montag, 14. September 2015, 14:23 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mit dem Klick auf F kommt man beim Eintrag zum Faksimile des Artikel z.B.
https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=aachenfahrt&firstterm=a
Ist mir bisher noch nicht aufgefallen.
https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=aachenfahrt&firstterm=a
Ist mir bisher noch nicht aufgefallen.
KlausGraf - am Sonntag, 13. September 2015, 16:07 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.namenforschung.net/dfd/
Tobias A. Kemper hat sich das neue Angebot gründlich angesehen und eine dreiteilige sorgfältige Bewertung publiziert.
https://saecula.de/dfd_1
https://saecula.de/dfd_2
https://saecula.de/dfd_3
Seiner Kritik ist voll und ganz zuzustimmen. Aus der Sicht des Historikers befremdet vor allem die ahistorische Konzeption des Nachschlagewerks.
Einige ergänzende Kritikpunkte möchte ich beisteuern.
1. Das Potential eines DIGITALEN Nachschlagewerks wird nicht ansatzweise ausgeschöpft
Verbreitungskarten in der Weise anzubieten wie das DFD ist veraltet. Man darf heute erwarten, dass die Karten zoombar sind und auf der Basis von Anwendungen wie Google Maps oder Open Street Map erstellt wurden. Es gibt keine Orientierungsorte.
Es fehlen Verlinkungen zu einem Glossar bzw. Einführungsartikel.
Es fehlen Abbildungen.
Keine Spur von Nachnutzbarkeit (freie Lizenz).
https://www.namenforschung.net/dfd/impressum/
Es gibt keine Volltextsuche, nur eine solche für Namen.
Digitalisate sind nicht konsequent nachgewiesen, z.B. nicht
https://archive.org/details/oberdeutschesfl00buckgoog
2. Das Ansteuern eines bestimmten Namens ist zu schwer
Jeder, der auch nur für 5 Cent Verstand hat, würde auf die Idee kommen, die Anfangsbuchstaben z.B. Gra anzugeben, um einen möglichst raschen Zugriff auf den Namen via Browsing zu ermöglichen. Durch Klick auf >> kommt man 20 Seiten weiter, es gibt keine Möglichkeit, nur eine Seite weiterzugehen, abweichend von dem, was sonst üblich ist.
Wenn man keine Lust hat, 91 Seiten durchzusehen, kann man ja versuchen Gr oder Gra mit der Suche zu finden. Ziemlich dämlich ist, dass die ungewöhnliche Anfangstrunkierung vor der Endtrunkierung steht. Wer nicht weiß, was trunkieren bedeutet, schaut in die Röhre.
3. Das Wörterbuch bedient sich einer akademisch-verquasten Sprache und ist nichts fürs "Volk"
In der Regel werden einfache Leute von den Deutungen oft nur wenig verstehen. Es fehlt an einem Glossar, wo man z.B. "Metronym" findet.
"Es handelt sich um einen lokalisierten Berufsnamen für einen an einem Graben situierten Schröder. Die vorliegende Form weist im Zweitglied gegenüber dem Etymon schrōder einen Ausfall von d auf, der in vielen westniederdeutschen Dialekten in intervokalischer Stellung eingetreten ist. Das Erstglied wurde hier verhochdeutscht."
"Es handelt sich um einen lokalisierten Berufsnamen für einen an oder auf einem Feld situierten Handwerker, der mit einem Schneidewerkzeug arbeitet. Hier liegt ein patronymischer starker Genitiv mit dem Suffix -s vor."
Noch Fragen?
Wer könnte wohl auf dem Feld mit einem Schneidewerkzeug arbeiten? Hat jemand eine Idee?
Unter einem Beruf versteht die Allgemeinheit etwas anderes. Hier wird eine bestimmte Rolle innerhalb von Handlungsabläufen im agrarischen Kontext bezeichnet, die Landwirte (und ihre Familie) und Knechte oder Erntehelfer ausüben konnten.
4. Die Deutungen sind von Laien nicht nachvollziehbar
Als jemand, der von Namenkunde kaum Ahnung hat, gehöre auch ich zu dieser Gruppe.
Beispiele:
Brandmüller: Wieso bezieht sich das Erstglied zwingend auf eine Brandrodung?
Aumüller: Wieso kann sich der Name nicht auch auf den Flurnamen Au beziehen? Siehe etwa
https://cgi-host.uni-marburg.de/~hlgl/mhfb/id.cgi?lines=0&ex=rs&table=flurname&lemma=Lechen-Au-Weg&suchlemma=lechen-au-weg
"Benennung nach Beruf zu mittelniederdeutsch hofsnīder ‘Hofschneider’. Der Schneider kann hier auf zwei verschiedene Arten in Verbindung zu einem Hof, d.h. einem Fürstenhof, stehen: 1. Er arbeitet für einen Fürstenhof und stellt Kleider für diesen her. 2. Er übt sein Handwerk unter dem Schutz des Fürstenhofes aus; dabei ist er nicht an eine Zunft gebunden und somit von gewissen bürgerlichen Pflichten befreit." Wieso kann das nicht ein auf einem Hof (landwirtschaftliches Anwesen) situierter Arbeiter sein, der mit einem Schneidewerkzeug arbeitet?? Man vgl. zu Hofmüller: "Benennung nach Beruf zu mittelhochdeutsch hof ‘Hof, Gehöft’ und mittelhochdeutsch mülnære, mülner, müller ‘Müller’, für einen Müller, der einem Hof verpflichtet war."
Zur Namendeutung als eine Art Kaffeesatzleserei siehe auch meine Reichard-Rezension von 1991:
https://swbplus.bsz-bw.de/bsz015767450rez.htm
Tobias A. Kemper hat sich das neue Angebot gründlich angesehen und eine dreiteilige sorgfältige Bewertung publiziert.
https://saecula.de/dfd_1
https://saecula.de/dfd_2
https://saecula.de/dfd_3
Seiner Kritik ist voll und ganz zuzustimmen. Aus der Sicht des Historikers befremdet vor allem die ahistorische Konzeption des Nachschlagewerks.
Einige ergänzende Kritikpunkte möchte ich beisteuern.
1. Das Potential eines DIGITALEN Nachschlagewerks wird nicht ansatzweise ausgeschöpft
Verbreitungskarten in der Weise anzubieten wie das DFD ist veraltet. Man darf heute erwarten, dass die Karten zoombar sind und auf der Basis von Anwendungen wie Google Maps oder Open Street Map erstellt wurden. Es gibt keine Orientierungsorte.
Es fehlen Verlinkungen zu einem Glossar bzw. Einführungsartikel.
Es fehlen Abbildungen.
Keine Spur von Nachnutzbarkeit (freie Lizenz).
https://www.namenforschung.net/dfd/impressum/
Es gibt keine Volltextsuche, nur eine solche für Namen.
Digitalisate sind nicht konsequent nachgewiesen, z.B. nicht
https://archive.org/details/oberdeutschesfl00buckgoog
2. Das Ansteuern eines bestimmten Namens ist zu schwer
Jeder, der auch nur für 5 Cent Verstand hat, würde auf die Idee kommen, die Anfangsbuchstaben z.B. Gra anzugeben, um einen möglichst raschen Zugriff auf den Namen via Browsing zu ermöglichen. Durch Klick auf >> kommt man 20 Seiten weiter, es gibt keine Möglichkeit, nur eine Seite weiterzugehen, abweichend von dem, was sonst üblich ist.
Wenn man keine Lust hat, 91 Seiten durchzusehen, kann man ja versuchen Gr oder Gra mit der Suche zu finden. Ziemlich dämlich ist, dass die ungewöhnliche Anfangstrunkierung vor der Endtrunkierung steht. Wer nicht weiß, was trunkieren bedeutet, schaut in die Röhre.
3. Das Wörterbuch bedient sich einer akademisch-verquasten Sprache und ist nichts fürs "Volk"
In der Regel werden einfache Leute von den Deutungen oft nur wenig verstehen. Es fehlt an einem Glossar, wo man z.B. "Metronym" findet.
"Es handelt sich um einen lokalisierten Berufsnamen für einen an einem Graben situierten Schröder. Die vorliegende Form weist im Zweitglied gegenüber dem Etymon schrōder einen Ausfall von d auf, der in vielen westniederdeutschen Dialekten in intervokalischer Stellung eingetreten ist. Das Erstglied wurde hier verhochdeutscht."
"Es handelt sich um einen lokalisierten Berufsnamen für einen an oder auf einem Feld situierten Handwerker, der mit einem Schneidewerkzeug arbeitet. Hier liegt ein patronymischer starker Genitiv mit dem Suffix -s vor."
Noch Fragen?
Wer könnte wohl auf dem Feld mit einem Schneidewerkzeug arbeiten? Hat jemand eine Idee?
Unter einem Beruf versteht die Allgemeinheit etwas anderes. Hier wird eine bestimmte Rolle innerhalb von Handlungsabläufen im agrarischen Kontext bezeichnet, die Landwirte (und ihre Familie) und Knechte oder Erntehelfer ausüben konnten.
4. Die Deutungen sind von Laien nicht nachvollziehbar
Als jemand, der von Namenkunde kaum Ahnung hat, gehöre auch ich zu dieser Gruppe.
Beispiele:
Brandmüller: Wieso bezieht sich das Erstglied zwingend auf eine Brandrodung?
Aumüller: Wieso kann sich der Name nicht auch auf den Flurnamen Au beziehen? Siehe etwa
https://cgi-host.uni-marburg.de/~hlgl/mhfb/id.cgi?lines=0&ex=rs&table=flurname&lemma=Lechen-Au-Weg&suchlemma=lechen-au-weg
"Benennung nach Beruf zu mittelniederdeutsch hofsnīder ‘Hofschneider’. Der Schneider kann hier auf zwei verschiedene Arten in Verbindung zu einem Hof, d.h. einem Fürstenhof, stehen: 1. Er arbeitet für einen Fürstenhof und stellt Kleider für diesen her. 2. Er übt sein Handwerk unter dem Schutz des Fürstenhofes aus; dabei ist er nicht an eine Zunft gebunden und somit von gewissen bürgerlichen Pflichten befreit." Wieso kann das nicht ein auf einem Hof (landwirtschaftliches Anwesen) situierter Arbeiter sein, der mit einem Schneidewerkzeug arbeitet?? Man vgl. zu Hofmüller: "Benennung nach Beruf zu mittelhochdeutsch hof ‘Hof, Gehöft’ und mittelhochdeutsch mülnære, mülner, müller ‘Müller’, für einen Müller, der einem Hof verpflichtet war."
Zur Namendeutung als eine Art Kaffeesatzleserei siehe auch meine Reichard-Rezension von 1991:
https://swbplus.bsz-bw.de/bsz015767450rez.htm
KlausGraf - am Sonntag, 13. September 2015, 14:50 - Rubrik: Genealogie
Burg Wolfstal, Burg Bettringen und Burg Bargau, in: einhorn-Jahrbuch Schwäbisch Gmünd 1980, S. 204-215
Online (Scan mit OCR):
https://dx.doi.org/10.6094/UNIFR/10242
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-freidok-102423
Der Beitrag beschäftigt sich mit Burgen in und bei dem Schwäbisch Gmünder Stadtteil Bettringen (Burgstall am Klostersturz, der im 15. Jahrhundert als angebliche Burg Wolfstal und Sitz der ursprünglich Gmünder Geschlechterfamilie Wolf von Wolfstal galt; Bettringer Turm; Burg Bargau) sowie - als Exkurs - mit der bei Wetzgau gelegenen Burg Waldau. Versucht wird der Nachweis, dass die im 14. Jahrhundert als hohenlohisches Lehen erscheinende "Burg Bettringen" in Wirklichkeit die Burg Bargau war - ein territorialpolitisch motiviertes Versteckspiel?
Erneut behandelt habe ich die Problematik im Bettringer Heimatbuch 1999:
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-opus-90046
 Burg Waldau (Rekonstrukion)
Burg Waldau (Rekonstrukion)
Online (Scan mit OCR):
https://dx.doi.org/10.6094/UNIFR/10242
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-freidok-102423
Der Beitrag beschäftigt sich mit Burgen in und bei dem Schwäbisch Gmünder Stadtteil Bettringen (Burgstall am Klostersturz, der im 15. Jahrhundert als angebliche Burg Wolfstal und Sitz der ursprünglich Gmünder Geschlechterfamilie Wolf von Wolfstal galt; Bettringer Turm; Burg Bargau) sowie - als Exkurs - mit der bei Wetzgau gelegenen Burg Waldau. Versucht wird der Nachweis, dass die im 14. Jahrhundert als hohenlohisches Lehen erscheinende "Burg Bettringen" in Wirklichkeit die Burg Bargau war - ein territorialpolitisch motiviertes Versteckspiel?
Erneut behandelt habe ich die Problematik im Bettringer Heimatbuch 1999:
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-opus-90046
 Burg Waldau (Rekonstrukion)
Burg Waldau (Rekonstrukion)KlausGraf - am Freitag, 11. September 2015, 17:14 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Klaus Graf: Die Gmünder Ringsage. Entstehung und Entwicklung einer Staufer-Überlieferung. In: einhorn-Jahrbuch Schwäbisch Gmünd 1982, S. 129-150 ist jetzt online unter
https://dx.doi.org/10.6094/UNIFR/10241
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-freidok-102423
Behandelt wird die seit dem Ende des 16. Jahrhunderts in schriftlichen Quellen greifbare Ringsage der Stadt Schwäbisch Gmünd, die Ursprungsüberlieferung der St. Johanniskirche, derzufolge die Kirche einem Gelübde zufolge an der Stelle erbaut worden sein soll, an der Herzogin Agnes, Gemahlin des ersten Stauferherzogs Friedrich I., ihren Ehering wiedergefunden habe. Eine Parallele besitzt diese Staufer-Tradition in der Klosterneuburger Schleierlegende, in der es um den Verlust des Brautschleiers der gleichen Agnes geht. Herausgearbeitet werden die unterschiedlichen Bedeutungen der Überlieferung.
Weitergeführt wurden die Überlegungen 1987:
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-opus-58410
Zur Ringsage siehe hier:
https://archiv.twoday.net/stories/1022460708/

https://dx.doi.org/10.6094/UNIFR/10241
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-freidok-102423
Behandelt wird die seit dem Ende des 16. Jahrhunderts in schriftlichen Quellen greifbare Ringsage der Stadt Schwäbisch Gmünd, die Ursprungsüberlieferung der St. Johanniskirche, derzufolge die Kirche einem Gelübde zufolge an der Stelle erbaut worden sein soll, an der Herzogin Agnes, Gemahlin des ersten Stauferherzogs Friedrich I., ihren Ehering wiedergefunden habe. Eine Parallele besitzt diese Staufer-Tradition in der Klosterneuburger Schleierlegende, in der es um den Verlust des Brautschleiers der gleichen Agnes geht. Herausgearbeitet werden die unterschiedlichen Bedeutungen der Überlieferung.
Weitergeführt wurden die Überlegungen 1987:
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-opus-58410
Zur Ringsage siehe hier:
https://archiv.twoday.net/stories/1022460708/
KlausGraf - am Freitag, 11. September 2015, 17:00 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.radiobremen.de/nachrichten/gesellschaft/wrackpluenderer100.html
Kulturgut darf grundsätzlich nicht ohne Erlaubnis geborgen werden", sagte die Direktorin des Deutschen Schiffahrtsmuseums in Bremerhaven, Sunhild Kleingärtner.
Kulturgut darf grundsätzlich nicht ohne Erlaubnis geborgen werden", sagte die Direktorin des Deutschen Schiffahrtsmuseums in Bremerhaven, Sunhild Kleingärtner.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.morgenpost.de/kultur/article205668033/Das-Wunder-von-Wuerth.html
"Die schöne Muttergottes gilt als das teuerste je in Deutschland gehandelte Gemälde und steht auf der Kulturgutschutzliste, wonach dieses Werk Deutschland nicht verlassen darf. Würth hat davon profitiert, das sagt er auch. Wäre das Gemälde im Ausland versteigert worden, hätte es der Erbenfamilie 30 bis 50 Prozent mehr eingebracht, schätzt er. Er plädiert für ein neues Kulturgutschutzgesetz der EU-Staaten, wonach Werke nicht den Rechtsraum der EU verlassen dürfen."
Siehe auch
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/reinhold-wuerth-nennt-kulturschutz-vorhaben-kleinkariert-a-1051455.html
https://www.esslinger-zeitung.de/lokal/kultur/schaufenster/Artikel1361473.cfm
Zur Verkauf der Holbein-Madonna:
https://archiv.twoday.net/stories/38758856/

"Die schöne Muttergottes gilt als das teuerste je in Deutschland gehandelte Gemälde und steht auf der Kulturgutschutzliste, wonach dieses Werk Deutschland nicht verlassen darf. Würth hat davon profitiert, das sagt er auch. Wäre das Gemälde im Ausland versteigert worden, hätte es der Erbenfamilie 30 bis 50 Prozent mehr eingebracht, schätzt er. Er plädiert für ein neues Kulturgutschutzgesetz der EU-Staaten, wonach Werke nicht den Rechtsraum der EU verlassen dürfen."
Siehe auch
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/reinhold-wuerth-nennt-kulturschutz-vorhaben-kleinkariert-a-1051455.html
https://www.esslinger-zeitung.de/lokal/kultur/schaufenster/Artikel1361473.cfm
Zur Verkauf der Holbein-Madonna:
https://archiv.twoday.net/stories/38758856/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Von Günther Wessel:
https://www.deutschlandradiokultur.de/raubgrabungen-das-schmutzige-geschaeft-mit-der-antike.976.de.html?dram:article_id=330465
https://www.deutschlandradiokultur.de/raubgrabungen-das-schmutzige-geschaeft-mit-der-antike.976.de.html?dram:article_id=330465
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ich lass mal den geneigten LeserInnen den Vortritt und frage: In welche Region gehört die Namensliste in einem Missale, online in den USA? Was sind das für Adelige?
https://digital.tcl.sc.edu/cdm/ref/collection/pfp/id/2966

https://digital.tcl.sc.edu/cdm/ref/collection/pfp/id/2966

KlausGraf - am Donnerstag, 10. September 2015, 01:30 - Rubrik: Kodikologie
https://www.heimatverein-rosstal.de/literatur/rohn-1928/38-sagen.htm
Die 2 ältesten Sagen von Roßtal sind einem Rechtsgutachten entnommen, das in einem Streit zwischen den Richterämtern Roßtal und Cadolzburg wegen der Zugehörigkeit von Vincenzenbronn um 1620 gefertigt wurde.
I. Wann nur der Gaul Flügel gehabt hat!
Sonsten wird viel von der Kirchen gesagt, als daß wo sie jetzt stehet, hab ein Pferd eine Glocke ausgescharret, darumben man unter diese noch ein Kirchlein da vor Augen gebauet, item dasselb Pferd sei von der Spitzen außerhalb den alten Wall vom Felsen, darinnen man die Fußstapfen vor 3 Jahren noch weisen können und von einem Maurer im Steinbrechen verworfen worden, bis gen Reytterach auf einen Sprung gesprungen, und von Reuttersach gen Gottmannsdorf, dahin man das Kirchlein erbaut, doch mags glauben wer da will, wann nur der Gaul Flügel gehabt hat.
II. Von der Hunnenschlacht
So hält man auch dafür, welches auch am glaublichsten, als die Stadt von den Hungern und Matzen (Davon der Hungern- und Matzenberg seinen Namen bekommen), sei belagert worden, da habe ein Herzog aus Bayern dieselbe entsetzt, auch den Feind albereit geschlagen, und als er die victory gesehen, sei er auf die Walstatt, die Erschlagenen zu sehen, geritten, (welches ihm doch durch sein Gemahl oder andere getreue Räte widerraten worden,) der darauf von einem unter den Toten und Verwunden liegenden Hungern, der seinen Bogen noch gespannt gehabt mit einem Pfeil durch das Visier geschossen, und also verwund worden, daß er des Todes sein müssen, … solches hatte sich der Feind wieder an die Stadt gemacht und dieselbe erobert, der Herzog aber wäre, wo jetzt die Kirche stehet, begraben worden.
Die 2 ältesten Sagen von Roßtal sind einem Rechtsgutachten entnommen, das in einem Streit zwischen den Richterämtern Roßtal und Cadolzburg wegen der Zugehörigkeit von Vincenzenbronn um 1620 gefertigt wurde.
I. Wann nur der Gaul Flügel gehabt hat!
Sonsten wird viel von der Kirchen gesagt, als daß wo sie jetzt stehet, hab ein Pferd eine Glocke ausgescharret, darumben man unter diese noch ein Kirchlein da vor Augen gebauet, item dasselb Pferd sei von der Spitzen außerhalb den alten Wall vom Felsen, darinnen man die Fußstapfen vor 3 Jahren noch weisen können und von einem Maurer im Steinbrechen verworfen worden, bis gen Reytterach auf einen Sprung gesprungen, und von Reuttersach gen Gottmannsdorf, dahin man das Kirchlein erbaut, doch mags glauben wer da will, wann nur der Gaul Flügel gehabt hat.
II. Von der Hunnenschlacht
So hält man auch dafür, welches auch am glaublichsten, als die Stadt von den Hungern und Matzen (Davon der Hungern- und Matzenberg seinen Namen bekommen), sei belagert worden, da habe ein Herzog aus Bayern dieselbe entsetzt, auch den Feind albereit geschlagen, und als er die victory gesehen, sei er auf die Walstatt, die Erschlagenen zu sehen, geritten, (welches ihm doch durch sein Gemahl oder andere getreue Räte widerraten worden,) der darauf von einem unter den Toten und Verwunden liegenden Hungern, der seinen Bogen noch gespannt gehabt mit einem Pfeil durch das Visier geschossen, und also verwund worden, daß er des Todes sein müssen, … solches hatte sich der Feind wieder an die Stadt gemacht und dieselbe erobert, der Herzog aber wäre, wo jetzt die Kirche stehet, begraben worden.
KlausGraf - am Donnerstag, 10. September 2015, 00:07 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wer intensiv nach sprachlichen Wendungen in Google Books sucht, erlebt es immer wieder, dass er gewünschte Treffer nicht findet, weil die Suchmaschine ihn bevormundet und bestimmte Zeichenfolgen nicht als sinnvolle Suche ansieht.
Angeblich gibt es nur 32 Treffer für "what a jump".
Davon enthält einer die Zeichenfolge "what a jump for".
Sucht man nach "what a jump for" findet man aber acht Treffer mit drei Varianten:
"What a jump for a man" (4)
"What a jump for me" (1)
"What a jump for joy" (3)
"What a jump for a man" liefert zwei zusätzliche Ergebnisse.
"What a jump for a" ergibt nur Treffer für "What a jump for a man".
Von den drei Phrasen ist aber nur "What a jump for joy" in der Trefferliste von "a jump for" vertreten!
Es gibt: "was a jump" for a tile-stove (2 Werke). Aber:
Ihre Suchanfrage ""was a jump for a"" stimmt mit keinem Buchergebnis überein.
Bei "devil of a jump" vermisst man die Treffer für "devil of a jump for" und bei letzterer Suche den Volltext:
https://books.google.de/books?id=Q-lAAAAAcAAJ&pg=PA186
Nicht gefunden wurde bei "what a jump for" "What a jump for a calf", das aber ebenfalls vertreten ist (zweimal, aber beides die gleiche Ausgabe 1852).
Aber genau das war der Sinn der Abfrage: erstaunte Ausrufe des Typs "was für ein Sprung für ein XYZ!" auf Englisch zu finden. Linguistische und andere Studien, die exakte und vollständige Ergebnisse zu Phrasensuchen benötigen, werden so erschwert und verunmöglicht.
Frühere Beobachtungen
https://archiv.twoday.net/stories/948995548/
https://archiv.twoday.net/stories/444877868/
Meinungen?

Angeblich gibt es nur 32 Treffer für "what a jump".
Davon enthält einer die Zeichenfolge "what a jump for".
Sucht man nach "what a jump for" findet man aber acht Treffer mit drei Varianten:
"What a jump for a man" (4)
"What a jump for me" (1)
"What a jump for joy" (3)
"What a jump for a man" liefert zwei zusätzliche Ergebnisse.
"What a jump for a" ergibt nur Treffer für "What a jump for a man".
Von den drei Phrasen ist aber nur "What a jump for joy" in der Trefferliste von "a jump for" vertreten!
Es gibt: "was a jump" for a tile-stove (2 Werke). Aber:
Ihre Suchanfrage ""was a jump for a"" stimmt mit keinem Buchergebnis überein.
Bei "devil of a jump" vermisst man die Treffer für "devil of a jump for" und bei letzterer Suche den Volltext:
https://books.google.de/books?id=Q-lAAAAAcAAJ&pg=PA186
Nicht gefunden wurde bei "what a jump for" "What a jump for a calf", das aber ebenfalls vertreten ist (zweimal, aber beides die gleiche Ausgabe 1852).
Aber genau das war der Sinn der Abfrage: erstaunte Ausrufe des Typs "was für ein Sprung für ein XYZ!" auf Englisch zu finden. Linguistische und andere Studien, die exakte und vollständige Ergebnisse zu Phrasensuchen benötigen, werden so erschwert und verunmöglicht.
Frühere Beobachtungen
https://archiv.twoday.net/stories/948995548/
https://archiv.twoday.net/stories/444877868/
Meinungen?
Wer mit solchem moralischem Anspruch und einer mitunter irritierenden Verbissenheit auftritt wie das Bildblog (übrigens fast immer eine lohnende Lektüre), darf sich nicht wundern, wenn eigene grobe Fehler genüsslich kolportiert werden:
https://meedia.de/2015/09/09/mangelnde-journalistische-sorgfalt-bildblog-loescht-artikel-und-entschuldigt-sich-bei-ex-bild-chef/
https://meedia.de/2015/09/09/mangelnde-journalistische-sorgfalt-bildblog-loescht-artikel-und-entschuldigt-sich-bei-ex-bild-chef/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://meedia.de/2015/09/09/schlappe-fuer-lsr-verlage-kartellamt-leitet-kein-verfahren-gegen-google-ein/
Update: https://www.internet-law.de/2015/09/leistungsschutzrecht-verlage-blitzen-beim-kartellamt-ab.html mit Hinweis auf die ausführliche Entscheidungsbegründung
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Entscheidungen/Missbrauchsaufsicht/2015/B6-126-14.pdf
Update: https://www.internet-law.de/2015/09/leistungsschutzrecht-verlage-blitzen-beim-kartellamt-ab.html mit Hinweis auf die ausführliche Entscheidungsbegründung
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Entscheidungen/Missbrauchsaufsicht/2015/B6-126-14.pdf
KlausGraf - am Mittwoch, 9. September 2015, 19:05 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://the1709blog.blogspot.de/2015/09/is-paper-book-sharing-app-illegal-under.html
Wie krank muss man eigentlich sein, um so etwas zu beanstanden? Nach deutschem Recht erlaubt der Erschöpfungsgrundsatz, rechtmäßig erworbene Bücher zu verkaufen oder zu verleihen.
Wie krank muss man eigentlich sein, um so etwas zu beanstanden? Nach deutschem Recht erlaubt der Erschöpfungsgrundsatz, rechtmäßig erworbene Bücher zu verkaufen oder zu verleihen.
KlausGraf - am Mittwoch, 9. September 2015, 19:00 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Übersetzt von Gerald Langhanke:
https://www.leidenmanifesto.org/uploads/4/1/6/0/41603901/leiden_manifesto_german__leidener_manifest.pdf
Zitat: "Schützen Sie die Spitzenleistungen der ortsbezogenen Forschung. In vielen
Teilen der Welt wird wissenschaftliche Spitzenleistung mit englischsprachiger
Veröffentlichung gleichgesetzt. Die spanische Rechtswissenschaft beispielsweise
erklärt es für wünschenswert, dass spanische Wissenschaftler in high-impactZeitschriften
veröffentlichen. Der impact factor wird für Zeitschriften berechnet,
die im US-bezogenen und immer noch größtenteils englischsprachigen Web of
Science ausgewertet werden. Diese Tendenzen sind besonders problematisch in
den Sozial- und Geisteswissenschaften, in denen die Forschung stärker regional
und national ausgerichtet ist. "
Siehe dazu auch
https://archiv.twoday.net/stories/1022470634/
Update: Leidener Manifest als Video
https://vimeo.com/133683418
https://www.leidenmanifesto.org/uploads/4/1/6/0/41603901/leiden_manifesto_german__leidener_manifest.pdf
Zitat: "Schützen Sie die Spitzenleistungen der ortsbezogenen Forschung. In vielen
Teilen der Welt wird wissenschaftliche Spitzenleistung mit englischsprachiger
Veröffentlichung gleichgesetzt. Die spanische Rechtswissenschaft beispielsweise
erklärt es für wünschenswert, dass spanische Wissenschaftler in high-impactZeitschriften
veröffentlichen. Der impact factor wird für Zeitschriften berechnet,
die im US-bezogenen und immer noch größtenteils englischsprachigen Web of
Science ausgewertet werden. Diese Tendenzen sind besonders problematisch in
den Sozial- und Geisteswissenschaften, in denen die Forschung stärker regional
und national ausgerichtet ist. "
Siehe dazu auch
https://archiv.twoday.net/stories/1022470634/
Update: Leidener Manifest als Video
https://vimeo.com/133683418
KlausGraf - am Mittwoch, 9. September 2015, 18:40 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/heinsberg/heimatverein-will-schatz-bergen-1.1017061
13.000 Euro soll die Übersetzung kosten.
Nach
https://www.rp-online.de/nrw/staedte/erkelenz/neues-licht-auf-uralte-stadtgeschichte-aid-1.4853079
soll das Gesamtprojekt 50.000 Euro kosten.Hier heißt es: "Mathias Baux war Stadtschreiber (1544-1558) und Bürgermeister (1562/63) von Erkelenz. In den Jahren seiner Stadtschreibertätigkeit legte Baux eine umfassende Chronik der Stadt und des Landes Geldern an, Historiker sprechen von einem Schatz, den Erkelenz bisher nicht gehoben hat. Ein Team um Professor Hiram Kümper von der Universität Mannheim hat sich dieser Aufgabe jetzt gestellt und will nächstes Jahr zwei Bücher herausgeben, einen Faksimiledruck mit Übersetzung und in einem zweiten Band eine Kommentierung."
Aus meiner Sicht alles maßlos überteuert.
Ausgabe Eckertz:
https://books.google.de/books?id=1wFBAAAAcAAJ&pg=PA3
 Ercka virago
Ercka virago
13.000 Euro soll die Übersetzung kosten.
Nach
https://www.rp-online.de/nrw/staedte/erkelenz/neues-licht-auf-uralte-stadtgeschichte-aid-1.4853079
soll das Gesamtprojekt 50.000 Euro kosten.Hier heißt es: "Mathias Baux war Stadtschreiber (1544-1558) und Bürgermeister (1562/63) von Erkelenz. In den Jahren seiner Stadtschreibertätigkeit legte Baux eine umfassende Chronik der Stadt und des Landes Geldern an, Historiker sprechen von einem Schatz, den Erkelenz bisher nicht gehoben hat. Ein Team um Professor Hiram Kümper von der Universität Mannheim hat sich dieser Aufgabe jetzt gestellt und will nächstes Jahr zwei Bücher herausgeben, einen Faksimiledruck mit Übersetzung und in einem zweiten Band eine Kommentierung."
Aus meiner Sicht alles maßlos überteuert.
Ausgabe Eckertz:
https://books.google.de/books?id=1wFBAAAAcAAJ&pg=PA3
 Ercka virago
Ercka viragoKlausGraf - am Mittwoch, 9. September 2015, 16:39 - Rubrik: Landesgeschichte
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/8693754
Aus: Josef Niessen: Sagen und Legenden vom Niederrhein, 1909 und 1911

Aus: Josef Niessen: Sagen und Legenden vom Niederrhein, 1909 und 1911
KlausGraf - am Mittwoch, 9. September 2015, 14:27 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Was meint ihr?
https://www.stern.de/lifestyle/leute/heidi-klum--foto-von-nacktem-po-auf-instagram-erntet-kritik-von-fans-6441230.html
https://rivva.de/243663729
https://de.wikipedia.org/wiki/In_China_ist_ein_Sack_Reis_umgefallen

https://www.stern.de/lifestyle/leute/heidi-klum--foto-von-nacktem-po-auf-instagram-erntet-kritik-von-fans-6441230.html
https://rivva.de/243663729
https://de.wikipedia.org/wiki/In_China_ist_ein_Sack_Reis_umgefallen

KlausGraf - am Mittwoch, 9. September 2015, 00:32 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Beitrag fragt nach den Quellen von sogenannten Volkssagen im Kirchheimer Raum, die gern als uraltes Volksgut missverstanden werden. Zu den einzelnen Abschnitten: Von Crusius bis Schwab (Hexensprung auf einem Kalb über das Lenninger Tal; Verena Beutlin); Schotts Sagensammlung (Sage zum Kirchheimer Freihof aus der Sammlung des Stuttgarter Lehrers Albert Schott des Jüngeren); Das Kirchheimer Kloster als Erzähl-Mal (Klosterbrand 1626); Fräulein Wolf und Carl Mayer: Sentimentale Lehrer(innen)-Poesie (die Kirchheimer Lehrerin Maria Wolf erstellte Sagenfassungen für Mayers Heimatbuch); Thomas Lirers "Schwäbische Chronik" und die Vogtberichte 1535 (der Druck 1485/86 hat die Vogtberichte beeinflusst); Sage und Literatur: Der Ulrichstein bei Hardt (Zeugnisse u.a. von Gustav Schwab, Wilhelm Hauff, Friedrich Hölderlin).
Klaus Graf: Sagen - kritische Gedanken zu Erzählungen aus dem Kirchheimer Raum. In: Schriftenreihe des Stadtarchivs Kirchheim unter Teck, Band 22 , 1998, S. 143-164
Online als Scan mit unkorrigierter OCR unter CC-BY-SA 4.0 auf Freidok:
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-freidok-101893
Zu weiteren Sagen-Studien von mir:
https://archiv.twoday.net/stories/4990762/
 https://de.wikisource.org/wiki/Der_Winkel_von_Hahrdt
https://de.wikisource.org/wiki/Der_Winkel_von_Hahrdt
Klaus Graf: Sagen - kritische Gedanken zu Erzählungen aus dem Kirchheimer Raum. In: Schriftenreihe des Stadtarchivs Kirchheim unter Teck, Band 22 , 1998, S. 143-164
Online als Scan mit unkorrigierter OCR unter CC-BY-SA 4.0 auf Freidok:
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-freidok-101893
Zu weiteren Sagen-Studien von mir:
https://archiv.twoday.net/stories/4990762/
 https://de.wikisource.org/wiki/Der_Winkel_von_Hahrdt
https://de.wikisource.org/wiki/Der_Winkel_von_HahrdtKlausGraf - am Dienstag, 8. September 2015, 23:35 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Royal Trust des UK bietet in seiner Datenbank Bilder in guter Auflösung an, leider nur ganz wenige Aufnahmen aus der Handschrift eines Fridericus Rutilius (1553) mit Zeichnungen zur Welfengeschichte.
https://www.royalcollection.org.uk/collection/search#/88/collection/1047589/historia-genealogica-principum-guelfforum
Zu bayerischen und welfischen Fürstenbildnissen sind die einschlägigen Einträge hier zusammengestellt in:
https://archiv.twoday.net/stories/1022415382/
#fnzhss

https://www.royalcollection.org.uk/collection/search#/88/collection/1047589/historia-genealogica-principum-guelfforum
Zu bayerischen und welfischen Fürstenbildnissen sind die einschlägigen Einträge hier zusammengestellt in:
https://archiv.twoday.net/stories/1022415382/
#fnzhss

KlausGraf - am Dienstag, 8. September 2015, 20:17 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Andere Projekte haben einen RSS-Feed, die Vaticana hat Herrn Piggin:
https://macrotypography.blogspot.de/
Ich sage einfach mal: Merci beaucoup.


https://macrotypography.blogspot.de/
Ich sage einfach mal: Merci beaucoup.


KlausGraf - am Dienstag, 8. September 2015, 20:00 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sehr geehrte Damen und Herren,
für Hinweise zum Sagensammeln am Niederrhein im 19./20. Jahrhundert, insbesondere zu Handschriftlichem, wäre ich dankbar.
Auf
https://www.krefeld.de/de/ehrengraeber/lentzen-johann-peter/
wird behauptet, Lentzen habe eine Sammlung "Sagen des Niederrheins" 1857 vorgelegt, die ich in wissenschaftlichen Bibliotheken nirgends nachweisen kann, und die ich sonst nur noch
https://www.google.de/search?q=%22sagen+des+niederrheins%22+lentzen&tbm=bks
finde. Kein Nachweis auch via
https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=189411341
1868 sagt
https://books.google.de/books?id=DME5AAAAcAAJ&pg=PA228
L. habe zusammen mit Konrad Noeven eine Sammlung veranstaltet, die der Drucklegung noch harre. Im Stadtarchiv Krefeld gibt es zu Lentzen einen Kleinstbestand 40/7 J.P. Lentzen, in dem Nr. 10 Sagen betrifft (nicht eingesehen).

Die ULB Düsseldorf hat gerade Lentzens Zeitschriften "Der Niederrhein : Zeitschrift für niederrheinische Geschichte und Alterthumskunde" und „Heimathskunde : Zeitschrift für niederrheinische Geschichte u. Altertumskunde“ unter
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/periodical/titleinfo/8680104
und
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/periodical/titleinfo/8680220
online gestellt. In ihnen sind auch wiederholt Sagen aufgenommen.
für Hinweise zum Sagensammeln am Niederrhein im 19./20. Jahrhundert, insbesondere zu Handschriftlichem, wäre ich dankbar.
Auf
https://www.krefeld.de/de/ehrengraeber/lentzen-johann-peter/
wird behauptet, Lentzen habe eine Sammlung "Sagen des Niederrheins" 1857 vorgelegt, die ich in wissenschaftlichen Bibliotheken nirgends nachweisen kann, und die ich sonst nur noch
https://www.google.de/search?q=%22sagen+des+niederrheins%22+lentzen&tbm=bks
finde. Kein Nachweis auch via
https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=189411341
1868 sagt
https://books.google.de/books?id=DME5AAAAcAAJ&pg=PA228
L. habe zusammen mit Konrad Noeven eine Sammlung veranstaltet, die der Drucklegung noch harre. Im Stadtarchiv Krefeld gibt es zu Lentzen einen Kleinstbestand 40/7 J.P. Lentzen, in dem Nr. 10 Sagen betrifft (nicht eingesehen).
Die ULB Düsseldorf hat gerade Lentzens Zeitschriften "Der Niederrhein : Zeitschrift für niederrheinische Geschichte und Alterthumskunde" und „Heimathskunde : Zeitschrift für niederrheinische Geschichte u. Altertumskunde“ unter
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/periodical/titleinfo/8680104
und
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/periodical/titleinfo/8680220
online gestellt. In ihnen sind auch wiederholt Sagen aufgenommen.
KlausGraf - am Dienstag, 8. September 2015, 19:14 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/8693455
Peter Josef Kreuzbergs Sammlung ist eine von vielen populären Rheinsagen-Sammlungen (siehe S. VIIf.). Der Autor Kreuzberg (1875 - 1939) war Lehrer, zuletzt Schulrat in Boppard, wo an ihn eine Straße erinnert.
Bopparder Persönlichkeiten. Wer war Peter Josef Kreuzberg?
In: Rund um Boppard. - Jg. 30. Boppard 1983. - Nr. 12 liegt mir nicht vor.
https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=126529450

Peter Josef Kreuzbergs Sammlung ist eine von vielen populären Rheinsagen-Sammlungen (siehe S. VIIf.). Der Autor Kreuzberg (1875 - 1939) war Lehrer, zuletzt Schulrat in Boppard, wo an ihn eine Straße erinnert.
Bopparder Persönlichkeiten. Wer war Peter Josef Kreuzberg?
In: Rund um Boppard. - Jg. 30. Boppard 1983. - Nr. 12 liegt mir nicht vor.
https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=126529450
KlausGraf - am Dienstag, 8. September 2015, 18:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In meinem Beitrag "Heroisches Herkommen" (1993)
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-opus-53061
bin ich kurz auch auf Straßennamen eingegangen, die im Spätmittelalter nach dämonischen Gestalten vor allem der Heldensage benannt wurden. Im Landkreis Balingen führte eine ehemalige Römerstraße den Namen Herchenweg. Fritz Scheerer: Herchenweg. In: Heimatkundliche Blätter Balingen 8 (1961) S. 354 hat ihr einen kurzen Beitrag gewidmet (PDF).
Geislinger Markung: Herchenweg rezent belegt
Markung Binsdorf 1513: "uff dem Herchenweg"
Markung Erlaheim 1610: "am Herchenweg"
Geislingen 1490: "am Herchenweg"
Scheerer nennt noch weitere Toponyme mit "Herchen", die er darauf bezieht.
Für Helmut Maurer handelte es sich 2013 dagegen um einen mittelalterlichen Fernweg (Artikel Rottweil im Handbuch der Königspfalzen):
https://books.google.de/books?id=rIkPEK0SSLUC&pg=PA3
Einigen uns auf "Altstraße", denn ob Römerstraße oder Fernweg ist für die Herkunft des Namens nicht relevant.
Hans Jänichen kam in seinem Hebsack-Aufsatz (Württembergisches Jahrbuch für Volkskunde 1956, S. 69-89, hier S. 82) auf ein Herchengericht im Balinger Raum zu sprechen und erwähnte als Bezeichnung für die Römerstraße den Herchenweg (ab 1490 belegt).
https://books.google.de/books?id=MDsOAQAAIAAJ&q="herchenweg"
Ohne Einzelnachweise hatte er die von Scheerer (ebenfalls ohne Einzelnachweise) genannten Bezeichnungen bereits in seinem Aufsatz "Baar und Huntari" 1952 (S. 141) aufgeführt.
https://dx.doi.org/10.11588/vuf.1976.0.15010
Scheerer (wie schon Jänichen 1952) leitet den Namen von der Gemahlin Etzels, die in der deutschen Heldensage Herche heißt, ab und verweist auf die Hildegartstraße am Bussen und die Kriemhildenstraße (Römerstraße Mengen-Offingen).
(Zur Hiltegardstraße sei an
https://archiv.twoday.net/stories/1022469438/ (zu Rees)
erinnert.)
Die Beziehung auf Frau Herche in der deutschen Heldensage erwähnte bereits die Oberamtsbeschreibung Balingen 1880:
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/oab_balingen1880/0259
Und schon die Blätter des Schwäbischen Albvereins 1909, Sp. 94 hatten auf die Trias der von Frauennamen abgeleiteten Straßen im südlichen Württemberg aufmerksam gemacht.
https://schwaben-kultur.de/cgi-bin/getpix.pl?obj=000000054/00009441&typ=image
Zum Namen von Etzels Frau Hireka, Herkia (Liederedda), Herche/Helche sei verwiesen auf Gottfried Schramm 1997
https://books.google.de/books?id=wcMyrjOjeccC&pg=PA119
Wilhelm Grimms Heldensage (Register der 3. Auflage 1889)
https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/urn/urn:nbn:de:hbz:6:1-84413
und Lienerts mangelhafte Dietrich-Testimonien, wo freilich im Register zu Helche S. 314 ausgerechnet das wichtige Zeugnis N 17 - Urkunde von 1185 über eine zerstörte Burg der Frau Helche bei Ybbs - fehlt, das ich nach Panzer angeführt hatte.
Weiteren Zeugnissen dazu aus Niederösterreich will ich heute nicht nachgehen:
https://www.google.de/search?tbm=bks&hl=de&q="domine+helchin"
https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22helchin%22+frau
https://de.wikipedia.org/wiki/Helchenburg (wenig kompetent: was ist das für ein Schmarren, einen Bezug auf die Helchen-Figur zu leugnen, weil die Anlage in Urkunden erwähnt werde)
https://www.zeitschrift-fuer-balkanologie.de/index.php/zfb/article/download/103/103 (Artikel von Kunstmann)
https://othes.univie.ac.at/2488/1/2008-11-06_9756109.pdf (Edition des Falsums angeblich von 1147 durch Birngruber)
https://bibliothekskatalog.noel.gv.at/!Jahrbuch!1914-15.pdf (Müller 1914/15)
Zurück zu den Belegen aus dem Balinger Raum. Sprachlich ist die Ableitung des Herchenwegs von der "fraw Herche" (so die Heldenbuchprosa z.B.
https://books.google.de/books?id=CUpcAAAAcAAJ&pg=PP15 ) ohne weiteres möglich. Die Parallele zu Hiltgarten- und Kriemhilds-Straße ist ansprechend. Aber da nicht ausdrücklich von einem Frau- Herchen-Weg die Rede ist, bleibt ein Zweifel.
[Mythologische Spekulationen Hockers zu Erka, Herka usw.:
https://books.google.de/books?id=GJE6AAAAcAAJ&pg=PA127
https://books.google.de/books?id=Pq5JAAAAcAAJ&pg=PA99
Frau Harke bei Mannhardt:
https://books.google.de/books?id=eC4OAAAAYAAJ&pg=PA298
Aus ungarischer Sicht:
https://books.google.de/books?id=-ixbAAAAQAAJ&pg=RA1-PA254
Siehe auch
https://books.google.de/books?id=l8aAAAAAMAAJ&q="frau+herke"
Zur Ercka virago in Erkelenz siehe die Abbildung
https://archiv.twoday.net/stories/1022472487/ ]
#heldensage
#forschung
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-opus-53061
bin ich kurz auch auf Straßennamen eingegangen, die im Spätmittelalter nach dämonischen Gestalten vor allem der Heldensage benannt wurden. Im Landkreis Balingen führte eine ehemalige Römerstraße den Namen Herchenweg. Fritz Scheerer: Herchenweg. In: Heimatkundliche Blätter Balingen 8 (1961) S. 354 hat ihr einen kurzen Beitrag gewidmet (PDF).
Geislinger Markung: Herchenweg rezent belegt
Markung Binsdorf 1513: "uff dem Herchenweg"
Markung Erlaheim 1610: "am Herchenweg"
Geislingen 1490: "am Herchenweg"
Scheerer nennt noch weitere Toponyme mit "Herchen", die er darauf bezieht.
Für Helmut Maurer handelte es sich 2013 dagegen um einen mittelalterlichen Fernweg (Artikel Rottweil im Handbuch der Königspfalzen):
https://books.google.de/books?id=rIkPEK0SSLUC&pg=PA3
Einigen uns auf "Altstraße", denn ob Römerstraße oder Fernweg ist für die Herkunft des Namens nicht relevant.
Hans Jänichen kam in seinem Hebsack-Aufsatz (Württembergisches Jahrbuch für Volkskunde 1956, S. 69-89, hier S. 82) auf ein Herchengericht im Balinger Raum zu sprechen und erwähnte als Bezeichnung für die Römerstraße den Herchenweg (ab 1490 belegt).
https://books.google.de/books?id=MDsOAQAAIAAJ&q="herchenweg"
Ohne Einzelnachweise hatte er die von Scheerer (ebenfalls ohne Einzelnachweise) genannten Bezeichnungen bereits in seinem Aufsatz "Baar und Huntari" 1952 (S. 141) aufgeführt.
https://dx.doi.org/10.11588/vuf.1976.0.15010
Scheerer (wie schon Jänichen 1952) leitet den Namen von der Gemahlin Etzels, die in der deutschen Heldensage Herche heißt, ab und verweist auf die Hildegartstraße am Bussen und die Kriemhildenstraße (Römerstraße Mengen-Offingen).
(Zur Hiltegardstraße sei an
https://archiv.twoday.net/stories/1022469438/ (zu Rees)
erinnert.)
Die Beziehung auf Frau Herche in der deutschen Heldensage erwähnte bereits die Oberamtsbeschreibung Balingen 1880:
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/oab_balingen1880/0259
Und schon die Blätter des Schwäbischen Albvereins 1909, Sp. 94 hatten auf die Trias der von Frauennamen abgeleiteten Straßen im südlichen Württemberg aufmerksam gemacht.
https://schwaben-kultur.de/cgi-bin/getpix.pl?obj=000000054/00009441&typ=image
Zum Namen von Etzels Frau Hireka, Herkia (Liederedda), Herche/Helche sei verwiesen auf Gottfried Schramm 1997
https://books.google.de/books?id=wcMyrjOjeccC&pg=PA119
Wilhelm Grimms Heldensage (Register der 3. Auflage 1889)
https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/urn/urn:nbn:de:hbz:6:1-84413
und Lienerts mangelhafte Dietrich-Testimonien, wo freilich im Register zu Helche S. 314 ausgerechnet das wichtige Zeugnis N 17 - Urkunde von 1185 über eine zerstörte Burg der Frau Helche bei Ybbs - fehlt, das ich nach Panzer angeführt hatte.
Weiteren Zeugnissen dazu aus Niederösterreich will ich heute nicht nachgehen:
https://www.google.de/search?tbm=bks&hl=de&q="domine+helchin"
https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22helchin%22+frau
https://de.wikipedia.org/wiki/Helchenburg (wenig kompetent: was ist das für ein Schmarren, einen Bezug auf die Helchen-Figur zu leugnen, weil die Anlage in Urkunden erwähnt werde)
https://www.zeitschrift-fuer-balkanologie.de/index.php/zfb/article/download/103/103 (Artikel von Kunstmann)
https://othes.univie.ac.at/2488/1/2008-11-06_9756109.pdf (Edition des Falsums angeblich von 1147 durch Birngruber)
https://bibliothekskatalog.noel.gv.at/!Jahrbuch!1914-15.pdf (Müller 1914/15)
Zurück zu den Belegen aus dem Balinger Raum. Sprachlich ist die Ableitung des Herchenwegs von der "fraw Herche" (so die Heldenbuchprosa z.B.
https://books.google.de/books?id=CUpcAAAAcAAJ&pg=PP15 ) ohne weiteres möglich. Die Parallele zu Hiltgarten- und Kriemhilds-Straße ist ansprechend. Aber da nicht ausdrücklich von einem Frau- Herchen-Weg die Rede ist, bleibt ein Zweifel.
[Mythologische Spekulationen Hockers zu Erka, Herka usw.:
https://books.google.de/books?id=GJE6AAAAcAAJ&pg=PA127
https://books.google.de/books?id=Pq5JAAAAcAAJ&pg=PA99
Frau Harke bei Mannhardt:
https://books.google.de/books?id=eC4OAAAAYAAJ&pg=PA298
Aus ungarischer Sicht:
https://books.google.de/books?id=-ixbAAAAQAAJ&pg=RA1-PA254
Siehe auch
https://books.google.de/books?id=l8aAAAAAMAAJ&q="frau+herke"
Zur Ercka virago in Erkelenz siehe die Abbildung
https://archiv.twoday.net/stories/1022472487/ ]
#heldensage
#forschung
KlausGraf - am Dienstag, 8. September 2015, 02:09 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://archiv.twoday.net/stories/1022471869/ hat mir keine Ruhe gelassen.
Auf der Rothenburger Stele steht:
KAISER
HEINRICH V.
VERLEIHT 1116
SEINEM NEFFEN
DEM SPÄTEREN KÖNIG
KONRAD III.
DEN TITEL EINES
·DVX ORIENTALIS
FRANCIAE
DE ROTINBURC·
https://www.stauferstelen.net/stele-rothenburg.htm
Richtig ist, dass nach dem Zeugnis Ekkehards von Aura Kaiser Heinrich V. 1116 - nach Gerhard Lubich: Auf dem Weg zur "Güldenen Freiheit" (1996), S. 167 in den ersten Januartagen "ducatum orientalis Francie", das ostfränkische Herzogtum, verliehen hat - aus Verärgerung über Bischof Erlung von Würzburg. Siehe dazu
https://www.regesta-imperii.de/id/1116-01-00_2_0_4_1_2_8_8
Das e-caudata der Quelle darf man auf einer Stele gern in ae übersetzen, aber von einem dux "de Rotinburc" verlautet bei Ekkehard nichts. Diese Formulierung wurde aus einer zweiten, außerordentlich unzuverlässigen Quelle entnommen, den Annales Spirenses aus dem 13. Jahrhundert.
Zitiert auch bei Petersohn: Franken S. 117
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf-sb/issue/view/1913
Lubich meinte zwar, dass Rothenburg nach dem Tod des letzten Grafen von Comburg-Rothenburg am 20. Januar 2016, an den Staufer Konrad fiel (S. 174), spricht sich aber dezidiert gegen einen Zusammenhang von Dukat-Verleihung und dem Comburg-Rothenburger-Grafenerbe aus: Da das Ableben Heinrichs erst Ende Januar bei Hofe bekannt geworden sei, sei auszuschließen, dass die Kochergaugrafschaft von Anfang an zu einer Amtsausstattung des ostfränkischen Dukats gehört habe (S. 169).
Gesichert ist das freilich nicht, wie die Diskussion des Sachverhalts in den Regesta Imperii zeigt:
https://www.regesta-imperii.de/id/1122-00-00_1_0_4_1_2_14_14
Dort wird der Erwerb der Kochergaugrafschaft vorsichtig mit "1122 oder 1116?" angesetzt.
Für 1122 plädierte Niederkorn in der ZWLG 1998 (S. 11-19). Damals habe der Würzburger Bischofskandidat Rugger, den Niederkorn als Erben des Komburg-Rothenburgischen Grafenhauses ansieht, sein Erbe dem Staufer Konrad übertragen - eine Hypothese, die mich nicht überzeugt. [Lubichs ablehnende Stellungnahme in der ZWLG 2000 ist online:
https://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a104679.pdf ]
Es ist zugegebenermaßen nicht undenkbar, dass die Grafschaft und der Herrensitz Rothenburg mit dem ostfränkischen Dukat an Konrad kam, aber beweisbar ist es nicht. [Lubich ZWLG 2000, S. 409 wandte sich mit Hinweis auf die Urkunde von 1142 - siehe unten - gegen die Ansicht, Rothenburg bzw. die Komburger Grafenburg sei mit der Grafschaft an Konrad gelangt.]
Die zeitgenössischen Quellen schweigen sich aus, und daher sollte man diesen Zusammenhang auch nicht als gesichertes Faktum in Stein meißeln.
Was aber gar nicht geht, ist, den aus den unzuverlässigen Annales Spirenses entnommenen Titel "de Rotinburc" dem zeitnahen Ekkehard-Zitat "dux orientalis Franciae" beizuschmuggeln und so den Eindruck einer einheitlichen Quellenaussage zu erwecken. Das ist Geschichtsklitterung!
Auf der Rothenburger Stele steht auch etwas zum Güterwerb Konrads III. 1142. Auch dazu gibt es verschiedene Ansichten:
https://books.google.de/books?id=TGzqAAAAMAAJ&q="burg+rothenburg"+detwang+1142
https://www.regesta-imperii.de/id/1142-04-00_2_0_4_1_2_239_238
Auf der Rothenburger Stele steht:
KAISER
HEINRICH V.
VERLEIHT 1116
SEINEM NEFFEN
DEM SPÄTEREN KÖNIG
KONRAD III.
DEN TITEL EINES
·DVX ORIENTALIS
FRANCIAE
DE ROTINBURC·
https://www.stauferstelen.net/stele-rothenburg.htm
Richtig ist, dass nach dem Zeugnis Ekkehards von Aura Kaiser Heinrich V. 1116 - nach Gerhard Lubich: Auf dem Weg zur "Güldenen Freiheit" (1996), S. 167 in den ersten Januartagen "ducatum orientalis Francie", das ostfränkische Herzogtum, verliehen hat - aus Verärgerung über Bischof Erlung von Würzburg. Siehe dazu
https://www.regesta-imperii.de/id/1116-01-00_2_0_4_1_2_8_8
Das e-caudata der Quelle darf man auf einer Stele gern in ae übersetzen, aber von einem dux "de Rotinburc" verlautet bei Ekkehard nichts. Diese Formulierung wurde aus einer zweiten, außerordentlich unzuverlässigen Quelle entnommen, den Annales Spirenses aus dem 13. Jahrhundert.
Zitiert auch bei Petersohn: Franken S. 117
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf-sb/issue/view/1913
Lubich meinte zwar, dass Rothenburg nach dem Tod des letzten Grafen von Comburg-Rothenburg am 20. Januar 2016, an den Staufer Konrad fiel (S. 174), spricht sich aber dezidiert gegen einen Zusammenhang von Dukat-Verleihung und dem Comburg-Rothenburger-Grafenerbe aus: Da das Ableben Heinrichs erst Ende Januar bei Hofe bekannt geworden sei, sei auszuschließen, dass die Kochergaugrafschaft von Anfang an zu einer Amtsausstattung des ostfränkischen Dukats gehört habe (S. 169).
Gesichert ist das freilich nicht, wie die Diskussion des Sachverhalts in den Regesta Imperii zeigt:
https://www.regesta-imperii.de/id/1122-00-00_1_0_4_1_2_14_14
Dort wird der Erwerb der Kochergaugrafschaft vorsichtig mit "1122 oder 1116?" angesetzt.
Für 1122 plädierte Niederkorn in der ZWLG 1998 (S. 11-19). Damals habe der Würzburger Bischofskandidat Rugger, den Niederkorn als Erben des Komburg-Rothenburgischen Grafenhauses ansieht, sein Erbe dem Staufer Konrad übertragen - eine Hypothese, die mich nicht überzeugt. [Lubichs ablehnende Stellungnahme in der ZWLG 2000 ist online:
https://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a104679.pdf ]
Es ist zugegebenermaßen nicht undenkbar, dass die Grafschaft und der Herrensitz Rothenburg mit dem ostfränkischen Dukat an Konrad kam, aber beweisbar ist es nicht. [Lubich ZWLG 2000, S. 409 wandte sich mit Hinweis auf die Urkunde von 1142 - siehe unten - gegen die Ansicht, Rothenburg bzw. die Komburger Grafenburg sei mit der Grafschaft an Konrad gelangt.]
Die zeitgenössischen Quellen schweigen sich aus, und daher sollte man diesen Zusammenhang auch nicht als gesichertes Faktum in Stein meißeln.
Was aber gar nicht geht, ist, den aus den unzuverlässigen Annales Spirenses entnommenen Titel "de Rotinburc" dem zeitnahen Ekkehard-Zitat "dux orientalis Franciae" beizuschmuggeln und so den Eindruck einer einheitlichen Quellenaussage zu erwecken. Das ist Geschichtsklitterung!
Auf der Rothenburger Stele steht auch etwas zum Güterwerb Konrads III. 1142. Auch dazu gibt es verschiedene Ansichten:
https://books.google.de/books?id=TGzqAAAAMAAJ&q="burg+rothenburg"+detwang+1142
https://www.regesta-imperii.de/id/1142-04-00_2_0_4_1_2_239_238

„Rothenburg-stauferstele“ von Geak (Diskussion) - Selbst fotografiert. Lizenziert unter Gemeinfrei über Wikimedia Commons.
KlausGraf - am Montag, 7. September 2015, 22:32 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
In der OA-Liste
https://lists.fu-berlin.de/pipermail/ipoa-forum/2015-September/thread.html
wird über Artikelgebühren diskutiert. Mein Kommentar:
Aus meiner Sicht ist allein der diamantene Open Access zukunftsfähig, bei der keine APCs anfallen, sondern die Veröffentlichungskosten durch Förderung des Anbieters (ob man den Verlag nennen mag, sei dahingestellt) erfolgt.
1. Open Access dient der Chancengleichheit, diese Einsicht geht hier zu vielen verloren.
Bei APCs sind wir von Chancengleichheit weit entfernt.
Das gilt auch für Monographien. Österreichische Fachbuchautoren dürfen auf dicke fette FWF-Zuschüsse hoffen, die tatsächlich viele wichtige geisteswissenschaftliche Monographien ins Netz bringt, während die DFG es bei Lippenbekenntnissen belässt - der Anteil der OA-Monographien ist hierzulande denn auch verschwindend gering.
Waiver-Bettelei ist unwürdig. Reiche Institutionen sorgen für ihre STM-Autoren, während bei den Geisteswissenschaften eine APC-Kultur ersichtlich nicht besteht. Da man der Ansicht ist, dass das eigene Institut keine APCs tragen kann, lässt man das OA-Publizieren ganz.
2. Die Kosten für das Publizieren werden extrem übertrieben.
Die Darlegungen von Shieber 2012 hat noch niemand schlüssig wiederlegt:
https://archiv.twoday.net/stories/75229491/
Niemand kann mir erzählen, dass Netzplatz oder eine Domain sonderlich teuer ist. Viele gute Journals werden mit OJS
https://pkp.sfu.ca/ojs/
betrieben. Eher luxuriös ist das Arxiv ausgestattet, aber auch da ist man bei den Kosten per Artikel meilenweit von den angeblich kostendeckenden Artikelkosten entfernt.
Womit prekär Beschäftigte ausgenutzt werden, ob zur Unterstützung der Publikationstätigkeit ihres Professors oder als Redakteur einer OA-Zeitschrift, hat hier keinerlei Rolle zu spielen. Günstiger OA bedeutet nicht, dass man Menschen ausnutzt.
Wie jede Lektoratstätigkeit ist Copy-Editing, dessen Bedeutung extrem überschätzt wird, außerordentlich lehrreich. Ehrenamtlich oder im Rahmen einer Anstellung sich damit zu befassen, ist durchaus zumutbar.
Nicht weniger organisierbar ist das Peer Review, wenn man nicht auf Open Review setzt. Qualität wird überschätzt, formulierte ich provokant:
https://digigw.hypotheses.org/1063
Die Herausgeber müssen den Manuskripteingang sichten und geeignete Beiträge an Peer Reviewer verteilen. Content-Management-Systeme helfen ihnen dabei. So what? Beide beteiligte Gruppen bekommen - üblicherweise - keinen Cent dafür, wie auch Wissenschaftsautoren anders als Belletristik-Autoren völlig leer ausgehen (vgl. aber § 32 UrhG).
Also: Was bitteschön ist so unglaublich teuer?
https://lists.fu-berlin.de/pipermail/ipoa-forum/2015-September/thread.html
wird über Artikelgebühren diskutiert. Mein Kommentar:
Aus meiner Sicht ist allein der diamantene Open Access zukunftsfähig, bei der keine APCs anfallen, sondern die Veröffentlichungskosten durch Förderung des Anbieters (ob man den Verlag nennen mag, sei dahingestellt) erfolgt.
1. Open Access dient der Chancengleichheit, diese Einsicht geht hier zu vielen verloren.
Bei APCs sind wir von Chancengleichheit weit entfernt.
Das gilt auch für Monographien. Österreichische Fachbuchautoren dürfen auf dicke fette FWF-Zuschüsse hoffen, die tatsächlich viele wichtige geisteswissenschaftliche Monographien ins Netz bringt, während die DFG es bei Lippenbekenntnissen belässt - der Anteil der OA-Monographien ist hierzulande denn auch verschwindend gering.
Waiver-Bettelei ist unwürdig. Reiche Institutionen sorgen für ihre STM-Autoren, während bei den Geisteswissenschaften eine APC-Kultur ersichtlich nicht besteht. Da man der Ansicht ist, dass das eigene Institut keine APCs tragen kann, lässt man das OA-Publizieren ganz.
2. Die Kosten für das Publizieren werden extrem übertrieben.
Die Darlegungen von Shieber 2012 hat noch niemand schlüssig wiederlegt:
https://archiv.twoday.net/stories/75229491/
Niemand kann mir erzählen, dass Netzplatz oder eine Domain sonderlich teuer ist. Viele gute Journals werden mit OJS
https://pkp.sfu.ca/ojs/
betrieben. Eher luxuriös ist das Arxiv ausgestattet, aber auch da ist man bei den Kosten per Artikel meilenweit von den angeblich kostendeckenden Artikelkosten entfernt.
Womit prekär Beschäftigte ausgenutzt werden, ob zur Unterstützung der Publikationstätigkeit ihres Professors oder als Redakteur einer OA-Zeitschrift, hat hier keinerlei Rolle zu spielen. Günstiger OA bedeutet nicht, dass man Menschen ausnutzt.
Wie jede Lektoratstätigkeit ist Copy-Editing, dessen Bedeutung extrem überschätzt wird, außerordentlich lehrreich. Ehrenamtlich oder im Rahmen einer Anstellung sich damit zu befassen, ist durchaus zumutbar.
Nicht weniger organisierbar ist das Peer Review, wenn man nicht auf Open Review setzt. Qualität wird überschätzt, formulierte ich provokant:
https://digigw.hypotheses.org/1063
Die Herausgeber müssen den Manuskripteingang sichten und geeignete Beiträge an Peer Reviewer verteilen. Content-Management-Systeme helfen ihnen dabei. So what? Beide beteiligte Gruppen bekommen - üblicherweise - keinen Cent dafür, wie auch Wissenschaftsautoren anders als Belletristik-Autoren völlig leer ausgehen (vgl. aber § 32 UrhG).
Also: Was bitteschön ist so unglaublich teuer?
KlausGraf - am Montag, 7. September 2015, 21:42 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"mit dem jüngsten Update enthält die GW-Datenbank übrigens genau 14.999 Einträge mit Links zu digitalisierten Inkunabeln. Soeben wurde als Nummer 15.000 hinzugefügt: GW M39296 Contra fastidiosos sacerdotes qui missas nimis longas dicere solent. Löwen: Thierry Martens, [um 1498/99]. Ex. der UB Gent: https://lib.ugent.be/catalog/bkt01:000386913 (Google Books: https://books.google.be/books?vid=GENT900000176380 ). Damit dürfte nunmehr etwa die Hälfte der in GW und ISTC verzeichneten Drucke, die in mindestens einem Exemplar erhalten sind, online verfügbar sein. Zahlreiche weitere Links, die noch „auf Halde liegen“, werden nach und nach in die Datenbank eingearbeitet werden." So Falk Eisermann in INCUNABULA-L.
Die faulen Bearbeiter von VD 16 und 17 sollten sich daran endlich ein Beispiel nehmen.
Die faulen Bearbeiter von VD 16 und 17 sollten sich daran endlich ein Beispiel nehmen.
KlausGraf - am Montag, 7. September 2015, 18:18 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
In der Liste DISKUS lesen wir
Nikolaus Czifra–Rüdiger Lorenz, Katalog der mittelalterlichen Handschriften in Salzburg: Stiftsbibliothek Mattsee, Archiv der Erzdiözese Salzburg, Salzburger Landesarchiv, Archiv der Stadt Salzburg, Salzburg Museum. Unter Mitarbeit von Beatrix Koll und Susanne Lang. Katalog- und Registerband (Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Denkschriften 475 = Veröffentlichungen zum Schrift- und Buchwesen des Mittelalters II,11). Wien 2015.
Von den im Katalog erschlossenen 263 Handschriften und Fragmenten des Kollegiatstifts Mattsee, des Archivs der Erzdiözese Salzburg, des Archivs der Stadt Salzburg, des Salzburger Landesarchivs und der Bibliothek des Salzburg Museums war bisher nur eine geringe Anzahl in Form von Inventaren des Hill Monastic Manuscript Library-Projekts verfügbar, so dass die hier beschriebenen Handschriften und Fragmente nun erstmals gemäß wissenschaftlichen Ansprüchen einer breiten Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zwar stammen die katalogisierten Handschriften überwiegend aus dem Spätmittelalter und dem bayerisch-österreichischen Raum, beinhalten zumeist Theologisches (Exegetisches, liturgisches Schrifttum, Predigtsammlungen), Juristisches (Kommentarliteratur oder Synodalakten) und Medizinisches (darunter die Handschriften des Salzburger Apothekers Zacharias Stewitz). Doch finden sich darunter ebenso Fragmente des neunten wie auch Handschriften des 16. Jahrhunderts; Oberitalien und Frankreich bilden zudem einen weiteren Schwerpunkt der Provenienzen.
Nikolaus Czifra ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Schrift- und Buchwesen des Mittelalters des Instituts für Mittelalterforschung der ÖAW.
Rüdiger Lorenz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte I des Historischen Seminars der Universität Freiburg.
Ein Verzeichnis der beschriebenen Handschriften mit Basisinformationen und Links zu online verfügbaren Digitalisaten von ausgewählten Handschriftenseiten finden Sie auf dem österreichischen Handschriftenportal manuscripta.at.
Die Drucklegung erfolgte mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). Gemäß den geltenden Regelungen steht der Katalog auch in einer open access-Ausgabe online auf der FWF-E-Book-Library zur Verfügung:
1) Katalogband: https://e-book.fwf.ac.at/o:811
2) Registerband: https://e-book.fwf.ac.at/o:812 (Hervorhebung von mir)
Für die Abbildungen hat man offenbar die uninteressantesten Handschriften ausgewählt. Hochrangige mittelalterliche Fragmente wie Heinrich von München (oder die Sächsische Weltchronik) erhalten kein Bild, von dem Wolfram-Fragment gibts idiotischerweise nur eine von 2 Seiten, während belanglose frühneuzeitliche Handschriften mit noch belangloseren
Bildern versehen werden. Wem nützt beispielsweise die Abbildung einer Seite einer Salzburger Stadt- und Polizeiordnung aus dem 16. Jahrhundert??
 Seite aus dem Stadtarchiv Salzburg
Seite aus dem Stadtarchiv Salzburg
Nikolaus Czifra–Rüdiger Lorenz, Katalog der mittelalterlichen Handschriften in Salzburg: Stiftsbibliothek Mattsee, Archiv der Erzdiözese Salzburg, Salzburger Landesarchiv, Archiv der Stadt Salzburg, Salzburg Museum. Unter Mitarbeit von Beatrix Koll und Susanne Lang. Katalog- und Registerband (Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Denkschriften 475 = Veröffentlichungen zum Schrift- und Buchwesen des Mittelalters II,11). Wien 2015.
Von den im Katalog erschlossenen 263 Handschriften und Fragmenten des Kollegiatstifts Mattsee, des Archivs der Erzdiözese Salzburg, des Archivs der Stadt Salzburg, des Salzburger Landesarchivs und der Bibliothek des Salzburg Museums war bisher nur eine geringe Anzahl in Form von Inventaren des Hill Monastic Manuscript Library-Projekts verfügbar, so dass die hier beschriebenen Handschriften und Fragmente nun erstmals gemäß wissenschaftlichen Ansprüchen einer breiten Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zwar stammen die katalogisierten Handschriften überwiegend aus dem Spätmittelalter und dem bayerisch-österreichischen Raum, beinhalten zumeist Theologisches (Exegetisches, liturgisches Schrifttum, Predigtsammlungen), Juristisches (Kommentarliteratur oder Synodalakten) und Medizinisches (darunter die Handschriften des Salzburger Apothekers Zacharias Stewitz). Doch finden sich darunter ebenso Fragmente des neunten wie auch Handschriften des 16. Jahrhunderts; Oberitalien und Frankreich bilden zudem einen weiteren Schwerpunkt der Provenienzen.
Nikolaus Czifra ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Schrift- und Buchwesen des Mittelalters des Instituts für Mittelalterforschung der ÖAW.
Rüdiger Lorenz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte I des Historischen Seminars der Universität Freiburg.
Ein Verzeichnis der beschriebenen Handschriften mit Basisinformationen und Links zu online verfügbaren Digitalisaten von ausgewählten Handschriftenseiten finden Sie auf dem österreichischen Handschriftenportal manuscripta.at.
Die Drucklegung erfolgte mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). Gemäß den geltenden Regelungen steht der Katalog auch in einer open access-Ausgabe online auf der FWF-E-Book-Library zur Verfügung:
1) Katalogband: https://e-book.fwf.ac.at/o:811
2) Registerband: https://e-book.fwf.ac.at/o:812 (Hervorhebung von mir)
Für die Abbildungen hat man offenbar die uninteressantesten Handschriften ausgewählt. Hochrangige mittelalterliche Fragmente wie Heinrich von München (oder die Sächsische Weltchronik) erhalten kein Bild, von dem Wolfram-Fragment gibts idiotischerweise nur eine von 2 Seiten, während belanglose frühneuzeitliche Handschriften mit noch belangloseren
Bildern versehen werden. Wem nützt beispielsweise die Abbildung einer Seite einer Salzburger Stadt- und Polizeiordnung aus dem 16. Jahrhundert??
 Seite aus dem Stadtarchiv Salzburg
Seite aus dem Stadtarchiv SalzburgKlausGraf - am Montag, 7. September 2015, 17:45 - Rubrik: Kodikologie
Zeigt Peter Koblank:
https://www.stauferstelen.net/texts/errata.htm
Update: Ortskundige könnten die Zahl der Fehler sicher noch vermehren.
Beispiel: Schwäbisch Gmünd.
https://www.stauferstelen.net/stele-gmuend.htm
Der Aufenthalt Heinrichs VI. (in der Transkription falsch Heinrich IV.,ich habe kein Foto dieser Seite im Netz gefunden, aber der Fehler dürfte auf das Konto von stauferstelen.net gehen [siehe mein Foto unten]) wird seit langem, u.a. in der maßgeblichen Stadtgeschichte von 1984 (Spranger/Graf) auf 1192, nicht 1193 datiert.
https://www.regesta-imperii.de/id/1192-06-20_1_0_4_3_1_298_232
[Zur Begründung:
WUB II
https://books.google.de/books?id=XYUqAAAAMAAJ&pg=295
Indiktion weist auf 1192 steht dort. Man kann in den Regesta Imperii nachschauen, dass eine ganze Reihe von Urkunden mit Datierung 1193 offenbar nach 1192 gehört. Erster Hinweis bei Regesta Imperii Nr. 214: wg. Indiktion und Itinerar 1192 nicht wie die Ausfertigung hat 1193.
https://regesta-imperii.digitale-sammlungen.de/seite/ri04_baa1972_0108
Itinerar im Sommer 1193: Juni 14 Koblenz, Juni 25-29 Worms. Und Juni 20 Gmünd? Ist das glaubhaft?
Bei 40 km/Tag optimistischer Reisegeschwindigkeit schaffte der König bei Abreise am 21. ab Gmünd es gerade, am 25. abends in Worms (200 km Autoroute) zu sein.
Wenn der König frühmorgens in Koblenz am 14. Juni geurkundet hat und sofort abgereist ist, war er am 20. abends noch 40 km von Gmünd entfernt (320 km Autoroute).
Zum Vergleich das Itinerar 1192: 1192 Juni 14 Wimpfen, Juli 8 Heidingsfeld bei Würzburg. Da passt ein Abstecher ins Stammland gut hinein.
Schon Hans-Martin Maurer: Der Hohenstaufen (1977), S. 47 mit Anm. 46 übernahm die Datierung 1192.
Autoritativ dazu jetzt auch das Manuskript zur Diplomata-Edition: "Da die Urkunde nach dem Itinerar in das Jahr 1192 gehören muß, ist hier offenbar derselbe Fehler in der Angabe des Inkarnationsjahres unterlaufen wie in einer ganzen Reihe von Kanzleiausfertigungen dieser Zeit"
https://www.mgh.de/fileadmin/Downloads/pdf/Heinrich_VI_2014-06-17.pdf
Volltextsuche im PDF nach Inkarnationsjahr liefert weitere Belege, aber anscheinend ist der Kommentar zum [D. 199] noch nicht online.]
Unnötig ist der Hinweis, dass Gotteszell zunächst ein "Augustinerinnen"-Kloster war. Ich schätze die Bezeichnung Augustinerinnen überhaupt nicht. Die Unterstellung der frommen Schwestern, die nach Augustinerregel lebten, unter den Dominikanerorden erfolgte schon 1246, aber auch nach 1246 lebten die Schwestern nach Augustinerregel (als Dominikanerinnen).
Fragwürdig ist, dass wiederholt dubiose Hypothesen in den Inschriften als Fakten hingestellt werden z.B. die Ausbildung Philipps von Schwaben in Adelberg.
Wer findet weitere Unrichtigkeiten auf den Stauferstelen?
Update:
https://archiv.twoday.net/stories/1022471990/
Die Überschrift wurde korrigiert. Auf Stauferstelen.net werden zu 16 Stelen Errata aufgelistet; hinzu kommt die Stele in Schwäbisch Gmünd.
https://www.stauferstelen.net/texts/errata.htm
Update: Ortskundige könnten die Zahl der Fehler sicher noch vermehren.
Beispiel: Schwäbisch Gmünd.
https://www.stauferstelen.net/stele-gmuend.htm
Der Aufenthalt Heinrichs VI. (in der Transkription falsch Heinrich IV.,
https://www.regesta-imperii.de/id/1192-06-20_1_0_4_3_1_298_232
[Zur Begründung:
WUB II
https://books.google.de/books?id=XYUqAAAAMAAJ&pg=295
Indiktion weist auf 1192 steht dort. Man kann in den Regesta Imperii nachschauen, dass eine ganze Reihe von Urkunden mit Datierung 1193 offenbar nach 1192 gehört. Erster Hinweis bei Regesta Imperii Nr. 214: wg. Indiktion und Itinerar 1192 nicht wie die Ausfertigung hat 1193.
https://regesta-imperii.digitale-sammlungen.de/seite/ri04_baa1972_0108
Itinerar im Sommer 1193: Juni 14 Koblenz, Juni 25-29 Worms. Und Juni 20 Gmünd? Ist das glaubhaft?
Bei 40 km/Tag optimistischer Reisegeschwindigkeit schaffte der König bei Abreise am 21. ab Gmünd es gerade, am 25. abends in Worms (200 km Autoroute) zu sein.
Wenn der König frühmorgens in Koblenz am 14. Juni geurkundet hat und sofort abgereist ist, war er am 20. abends noch 40 km von Gmünd entfernt (320 km Autoroute).
Zum Vergleich das Itinerar 1192: 1192 Juni 14 Wimpfen, Juli 8 Heidingsfeld bei Würzburg. Da passt ein Abstecher ins Stammland gut hinein.
Schon Hans-Martin Maurer: Der Hohenstaufen (1977), S. 47 mit Anm. 46 übernahm die Datierung 1192.
Autoritativ dazu jetzt auch das Manuskript zur Diplomata-Edition: "Da die Urkunde nach dem Itinerar in das Jahr 1192 gehören muß, ist hier offenbar derselbe Fehler in der Angabe des Inkarnationsjahres unterlaufen wie in einer ganzen Reihe von Kanzleiausfertigungen dieser Zeit"
https://www.mgh.de/fileadmin/Downloads/pdf/Heinrich_VI_2014-06-17.pdf
Volltextsuche im PDF nach Inkarnationsjahr liefert weitere Belege, aber anscheinend ist der Kommentar zum [D. 199] noch nicht online.]
Unnötig ist der Hinweis, dass Gotteszell zunächst ein "Augustinerinnen"-Kloster war. Ich schätze die Bezeichnung Augustinerinnen überhaupt nicht. Die Unterstellung der frommen Schwestern, die nach Augustinerregel lebten, unter den Dominikanerorden erfolgte schon 1246, aber auch nach 1246 lebten die Schwestern nach Augustinerregel (als Dominikanerinnen).
Fragwürdig ist, dass wiederholt dubiose Hypothesen in den Inschriften als Fakten hingestellt werden z.B. die Ausbildung Philipps von Schwaben in Adelberg.
Wer findet weitere Unrichtigkeiten auf den Stauferstelen?
Update:
https://archiv.twoday.net/stories/1022471990/
Die Überschrift wurde korrigiert. Auf Stauferstelen.net werden zu 16 Stelen Errata aufgelistet; hinzu kommt die Stele in Schwäbisch Gmünd.
„Schwaebisch gmuend sommer 2012 07“ von Klaus Graf - Eigenes Werk. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons.
KlausGraf - am Montag, 7. September 2015, 15:55 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
https://wwwextern.ubn.ru.nl/BookReader/Voortgang/Voortgang_project_scannen_Erfgoed.htm
Die Liste ist sicher unvollständig. Der GW verzeichnet derzeit 61 Inkunabeldigitalisate aus den Beständen der Radboud-Universität, darunter auch Drucke von Bernardus (v. Cl.) und Hieronymus Baldung, die in der Liste fehlen.
Es gibt aber auch Handschriften und jüngere Bücher, die bequem in dem vom Internet Archive bekannten Viewer gesichtet werden können. Eine Filtermöglichkeit im OPAC existiert nicht. Der OPAC ist sehr benutzerunfreundlich.
Die Liste ist sicher unvollständig. Der GW verzeichnet derzeit 61 Inkunabeldigitalisate aus den Beständen der Radboud-Universität, darunter auch Drucke von Bernardus (v. Cl.) und Hieronymus Baldung, die in der Liste fehlen.
Es gibt aber auch Handschriften und jüngere Bücher, die bequem in dem vom Internet Archive bekannten Viewer gesichtet werden können. Eine Filtermöglichkeit im OPAC existiert nicht. Der OPAC ist sehr benutzerunfreundlich.
KlausGraf - am Montag, 7. September 2015, 15:29 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
Das ist erfreulich. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass selbst erfahrene Inkunabelliebhaber, auch wenn sie berücksichtigen, dass anders als in fast allen vergleichbaren Datenbanken Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden werden, nicht selten das Gesuchte nicht aufspüren können.
Tipp: Suche nach Digitalisaten aus Nijmegen
[Feld] Reproduktionen - enthält - 'Nijmegen'
Das ist erfreulich. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass selbst erfahrene Inkunabelliebhaber, auch wenn sie berücksichtigen, dass anders als in fast allen vergleichbaren Datenbanken Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden werden, nicht selten das Gesuchte nicht aufspüren können.
Tipp: Suche nach Digitalisaten aus Nijmegen
[Feld] Reproduktionen - enthält - 'Nijmegen'
KlausGraf - am Montag, 7. September 2015, 14:57 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Recently identified unique #incunable on plague now catalogued! https://t.co/z3Azh5FCRk Thanks GW #marginaliamonday pic.twitter.com/cd6sMvqqOs
— Glasgow Uni Sp Coll (@GUspcoll) 7. September 2015
KlausGraf - am Montag, 7. September 2015, 14:53 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.kubon-sagner.de/opac.html?filter=series%3AOABD001E
Via
https://zkbw.blogspot.de/2015/09/bibliothek-und-medien-frei-verfugbar.html
Via
https://zkbw.blogspot.de/2015/09/bibliothek-und-medien-frei-verfugbar.html
KlausGraf - am Montag, 7. September 2015, 14:45 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.lz.de/lippe/oerlinghausen/20558408_Detmolder-Amtsgericht-bestaetigt-Hausverbot-fuer-rechtsextremen-Aktivisten.html
Das Amtsgericht Detmold stellt in seiner Urteilsbegründung fest, dass die Klage unbegründet ist und das ausgesprochene Hausverbot rechtmäßig erteilt wurde. Das Recht des privatrechtlichen Vereins „Archäologischen Freilichtmuseum Oerlinghausen“ sei auf Grund der Privatautonomie insgesamt höher anzusiedeln. Er sei aufgrund seines Hausrechts berechtigt, das Hausverbot auszusprechen und könne frei entscheiden, wem der Zutritt gewährt wird und wem nicht.
Auf öffentlichrechtlich organisierte Museen ist die Entscheidung offenkundig nicht übertragbar.
Kommentar: Teilhabe an Kultur ist grundsätzlich jedermann zu gewähren und damit auch die Möglichkeit, die eigene Überzeugung zu revidieren. Sobald Besucher auffällig werden oder gar andere Besucher einschüchtern oder in anderer Weise stören, kann und soll eingeschritten werden.
Nachtrag:
https://archiv.twoday.net/stories/117750371/
Das Amtsgericht Detmold stellt in seiner Urteilsbegründung fest, dass die Klage unbegründet ist und das ausgesprochene Hausverbot rechtmäßig erteilt wurde. Das Recht des privatrechtlichen Vereins „Archäologischen Freilichtmuseum Oerlinghausen“ sei auf Grund der Privatautonomie insgesamt höher anzusiedeln. Er sei aufgrund seines Hausrechts berechtigt, das Hausverbot auszusprechen und könne frei entscheiden, wem der Zutritt gewährt wird und wem nicht.
Auf öffentlichrechtlich organisierte Museen ist die Entscheidung offenkundig nicht übertragbar.
Kommentar: Teilhabe an Kultur ist grundsätzlich jedermann zu gewähren und damit auch die Möglichkeit, die eigene Überzeugung zu revidieren. Sobald Besucher auffällig werden oder gar andere Besucher einschüchtern oder in anderer Weise stören, kann und soll eingeschritten werden.
Nachtrag:
https://archiv.twoday.net/stories/117750371/
KlausGraf - am Montag, 7. September 2015, 14:37 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Gerda Henkel-Stiftung veröffentlichte vergangene Woche eine Hausarbeit (!) im Fach Germanistik über “Vorsatz, Erbsünde und Erlösung bei Hartmann von Aue“. Zwar inhaltlich durchaus gehaltvoll, sind die sprachlichen Fehler allein in der kurzen Vorschau bereits abschreckend …
https://blog.histofakt.de/?p=1233
https://blog.histofakt.de/?p=1233
https://folgerpedia.folger.edu/Interpreting_MARC_records
Manchmal muss man die MARC-Einträge konsultieren, um Provenienzdaten zu finden.
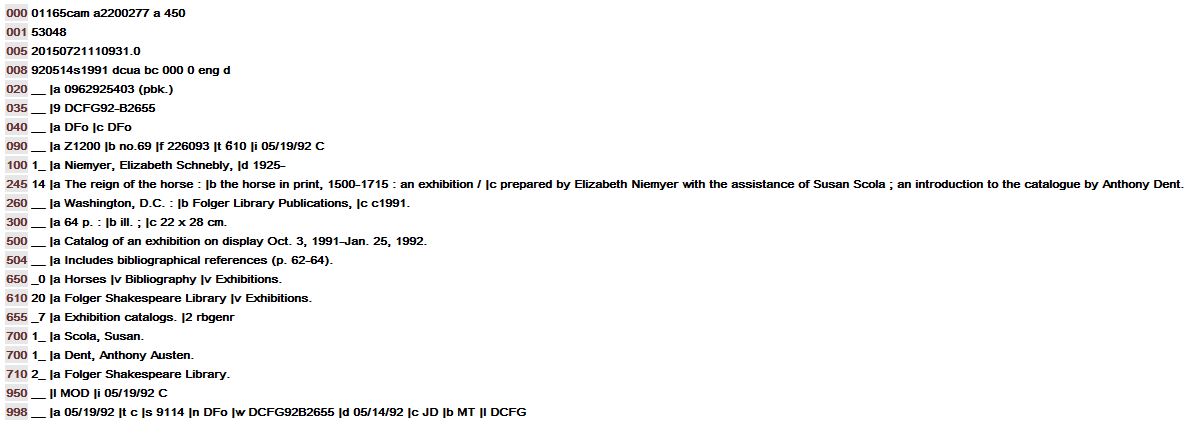
Manchmal muss man die MARC-Einträge konsultieren, um Provenienzdaten zu finden.
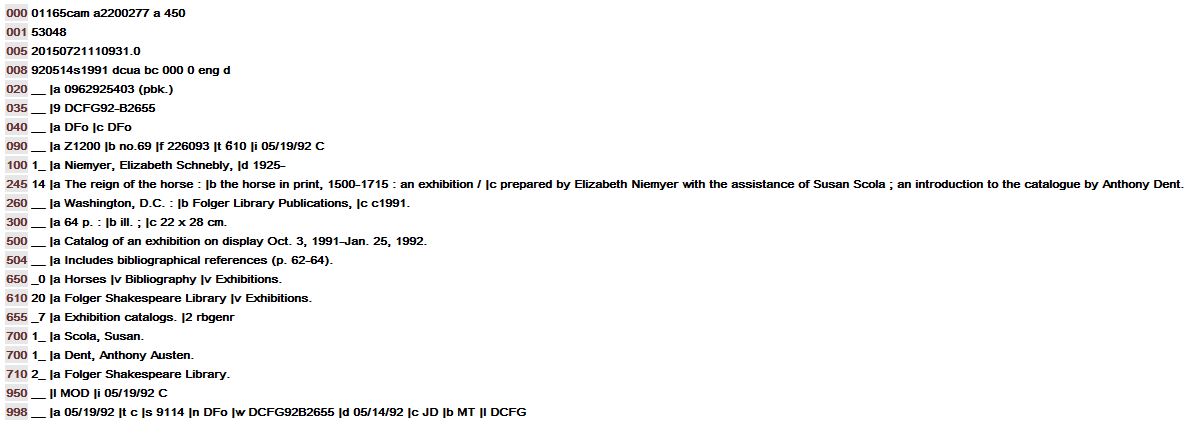
KlausGraf - am Montag, 7. September 2015, 14:32 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 7. September 2015, 14:24 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
BLB Karlsruhe St. Blasien 48
https://digital.blb-karlsruhe.de/id/3031778
Enthalten ist auch eine gekürzte Abschrift der Truchsessenchronik von Matthäus Marschalk von Pappenheim.
https://digital.blb-karlsruhe.de/blbihd/Drucke/content/pageview/67355
#fnzhss

https://digital.blb-karlsruhe.de/id/3031778
Enthalten ist auch eine gekürzte Abschrift der Truchsessenchronik von Matthäus Marschalk von Pappenheim.
https://digital.blb-karlsruhe.de/blbihd/Drucke/content/pageview/67355
#fnzhss
KlausGraf - am Montag, 7. September 2015, 14:15 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Es ist ein Unding, dass die Österreichische Apothekenkammer, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, nicht mit einem Eintrag im Handbuch der historischen Buchbestände vertreten ist (sie wird lediglich in der Einleitung zu Wien erwähnt).
https://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Oesterreich
Sie ist aber eine der größten pharmazeutischen Fachbibliotheken mit bemerkenswertem Altbestand.
https://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=37840
https://www.apothekerkammer.at/internet/oeak/NewsPresse.nsf/e02b9cd11265691ec1256a7d005209ee/b0c5e62d2ff9be91c1257b55002f84fc?OpenDocument
https://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Oesterreich
Sie ist aber eine der größten pharmazeutischen Fachbibliotheken mit bemerkenswertem Altbestand.
https://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=37840
https://www.apothekerkammer.at/internet/oeak/NewsPresse.nsf/e02b9cd11265691ec1256a7d005209ee/b0c5e62d2ff9be91c1257b55002f84fc?OpenDocument
KlausGraf - am Montag, 7. September 2015, 14:09 - Rubrik: Bibliothekswesen
https://lesewolke.wordpress.com/2015/09/07/gelesen-in-biblioblogs-36-kw15/
Von den sieben Abschnitten haben drei die Quelle Archivalia.
Von den sieben Abschnitten haben drei die Quelle Archivalia.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.siwiarchiv.de/?p=10312
https://www.danrw.de/
Die Universitäten des Landes sind keine Partner!
https://www.danrw.de/
Die Universitäten des Landes sind keine Partner!
KlausGraf - am Montag, 7. September 2015, 13:59 - Rubrik: Digitale Unterlagen
KlausGraf - am Montag, 7. September 2015, 13:57 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen