https://faculty.arts.ubc.ca/sechard/512digms.htm ist eine Linkliste zu digitalisierten mittelalterlichen Handschriften, die auch auf die Existenz von ganzen Manuskripten in LUNA-Anwendungen hinweist.
Bei der Rylands Library in Manchester kann man mittels des Suchbegriffs bookreader die ganzen Digitalisate auffinden.
Blockbuch auf Deutsch
https://luna.manchester.ac.uk/luna/servlet/s/dh68h9
In Oxford geht das leider nicht :-(
Bei der Rylands Library in Manchester kann man mittels des Suchbegriffs bookreader die ganzen Digitalisate auffinden.
Blockbuch auf Deutsch
https://luna.manchester.ac.uk/luna/servlet/s/dh68h9
In Oxford geht das leider nicht :-(
KlausGraf - am Samstag, 18. April 2015, 21:19 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 18. April 2015, 20:47 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.wien.gv.at/actaproweb2/benutzung/index.xhtml
Mit der Suche nach digitalisat und abgelaufen findet man vor allem Meldezettel, die man am Bildschirm einsehen kann.
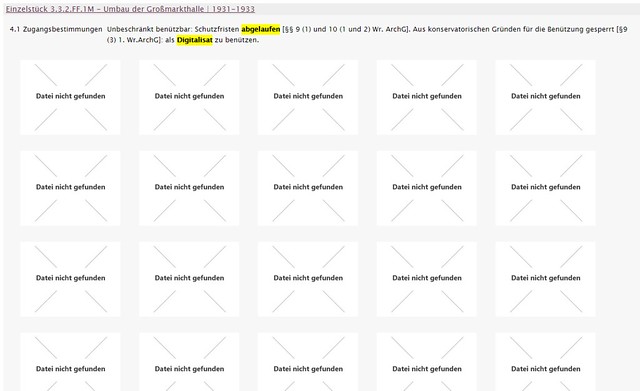
Mit der Suche nach digitalisat und abgelaufen findet man vor allem Meldezettel, die man am Bildschirm einsehen kann.
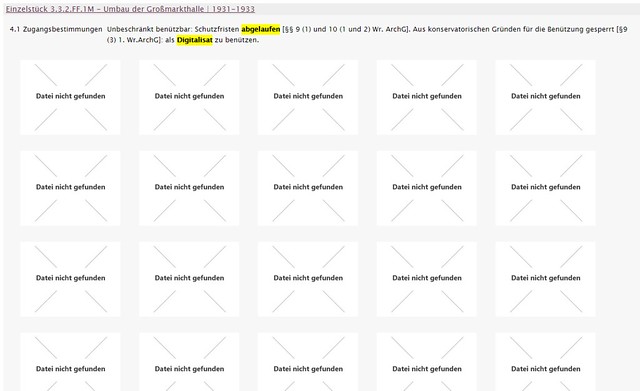
KlausGraf - am Samstag, 18. April 2015, 18:35 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.tagesschau.de/schlusslicht/fruehlingsgedichte-101.html
https://de.wikisource.org/wiki/Fr%C3%BChling

https://de.wikisource.org/wiki/Fr%C3%BChling

KlausGraf - am Samstag, 18. April 2015, 18:17 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Diverse Berichte:
https://www.univie.ac.at/voeb/blog/?cat=14
https://www.onb.ac.at/literaturmuseum.htm (wenig ergiebig)
 Original erhaltenes Amtszimmer des Archivdirektors Grillparzer
Original erhaltenes Amtszimmer des Archivdirektors Grillparzer
Quelle: https://www.onb.ac.at/services/pressefotos.php?foto=literaturmuseum
https://www.univie.ac.at/voeb/blog/?cat=14
https://www.onb.ac.at/literaturmuseum.htm (wenig ergiebig)
 Original erhaltenes Amtszimmer des Archivdirektors Grillparzer
Original erhaltenes Amtszimmer des Archivdirektors GrillparzerQuelle: https://www.onb.ac.at/services/pressefotos.php?foto=literaturmuseum
KlausGraf - am Samstag, 18. April 2015, 15:34 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.morgenpost.de/berlin/article139699558/Schabowskis-Zettel-soll-gestohlen-worden-sein.html
(Wieso überhaupt aus Privatbesitz?)
(Wieso überhaupt aus Privatbesitz?)
R.Schreg - am Samstag, 18. April 2015, 11:43 - Rubrik: Archivrecht
https://thestudio.uiowa.edu/fluxus/
Via
https://www.digitalsalon.net/fluxus-digital-collection-launch/
Via
https://www.digitalsalon.net/fluxus-digital-collection-launch/
KlausGraf - am Freitag, 17. April 2015, 23:27 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 17. April 2015, 16:39 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.oesta.gv.at/site/cob__59201/5164/default.aspx
"Am 25. März 2015, knapp vor der Vollendung seines 88. Lebensjahres, verstarb in Klosterneuburg der ehemalige Direktor des Haus-, Hof- und Staatsarchivs Gerhard Rill; Österreichs Archive und Geschichtswissenschaft haben mit seinem Tod einen wichtigen Vertreter verloren."
"Am 25. März 2015, knapp vor der Vollendung seines 88. Lebensjahres, verstarb in Klosterneuburg der ehemalige Direktor des Haus-, Hof- und Staatsarchivs Gerhard Rill; Österreichs Archive und Geschichtswissenschaft haben mit seinem Tod einen wichtigen Vertreter verloren."
KlausGraf - am Freitag, 17. April 2015, 14:44 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Es gelingt mir nicht, in dem Buch
https://books.google.de/books?id=SvJQAAAAcAAJ&q=stocker#v=snippet&q=stocker&f=false
auf die Seite 528 mit dem Artikel Stocker zu kommen, sie ist offenbar gescannt, aber zwischen 527 und 528 klafft eine Lücke.
Damit verschärft sich der
https://archiv.twoday.net/stories/1022378913/
geschilderte Befund.
https://books.google.de/books?id=SvJQAAAAcAAJ&q=stocker#v=snippet&q=stocker&f=false
auf die Seite 528 mit dem Artikel Stocker zu kommen, sie ist offenbar gescannt, aber zwischen 527 und 528 klafft eine Lücke.
Damit verschärft sich der
https://archiv.twoday.net/stories/1022378913/
geschilderte Befund.
KlausGraf - am Freitag, 17. April 2015, 04:26 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Lucia Assenzi widmet ihm in ihrer Magisterarbeit in Padua 2013/14 einen Abschnitt:
https://tesi.cab.unipd.it/47288/1/Lucia_Assenzi_-_Tesi_-_file_completo.pdf
1895 und 1896 hatte sich FWE Roth mit dieser Person befasst.
https://de.wikisource.org/wiki/Ferdinand_Wilhelm_Emil_Roth
GND
https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=11970000X
Zur Biographie siehe auch
https://retro.seals.ch/digbib/view?pid=chl-001:2009:39-40::33

https://tesi.cab.unipd.it/47288/1/Lucia_Assenzi_-_Tesi_-_file_completo.pdf
1895 und 1896 hatte sich FWE Roth mit dieser Person befasst.
https://de.wikisource.org/wiki/Ferdinand_Wilhelm_Emil_Roth
GND
https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=11970000X
Zur Biographie siehe auch
https://retro.seals.ch/digbib/view?pid=chl-001:2009:39-40::33
KlausGraf - am Freitag, 17. April 2015, 02:58 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://digitale-kulturanthropologie.de/
Vereinzelte Volltexte aus der Zeitschrift "Volkskunde in Rheinland-Pfalz".
Vereinzelte Volltexte aus der Zeitschrift "Volkskunde in Rheinland-Pfalz".
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 23:45 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zurück im Land des SS-Täters:
mit obszönen, "geschätzten" EUR 12.000,-- und unbedarften Angaben zu Josef Mengele ("Mediziner und Anthropologe") wird in der kommenden Auktion des Pforzheimer Buchauktionshauses Peter Kiefer (25.4.2015) ein Privatbrief des SS-Arztes "ausgerufen":
https://www.kiefer.de/auktion_artikel_details.aspx?KatNr=4124&Auktion=92.
Unbekannt ist dieser Brief nicht: Seit 2010 stand er bereits bei vier verschiedenen Auktionen in den USA und zuletzt 2014 in Berlin zum Verkauf. Nun also, am Ende einer fragwürdigen Preissteigerungskurve und mit ungeklärter Provenienz, wird der Brief mutmaßlich abermals in unbekanntem Privatbesitz verschwinden und nicht in einem seriösen Archiv gesichert überliefert.
Dass sowohl der anonyme "Einlieferer" und Besitzer als auch das Auktionshaus Kiefer keine Skrupel haben, den aktuellen "Marktwert" solcher NS-Devotionalien auszuloten, hochzutreiben und die Provisionen einzustreichen, versteht sich bedauerlicherweise von selbst. Und wieder wird an zeitgeschichtlichen Archiven vorbei schnelles Geld mit solchen NS-Dokumenten gemacht; unbekannt, in wessen Hände sie kommen und was mit ihnen geschieht.
________
Offener Brief an das Auktionshaus Peter Kiefer, Pforzheim, 16.4.2015:
Sehr geehrter Herr Kiefer,
dass Sie mit solchen Dokumenten unbedacht und offenkundig ohne Bedenken nun auch Ihr Haus zu einem unseriösen Marktplatz des NS-Devotionalienhandels machen, ist, milde gesagt, bedauerlich; tatsächlich ist es ein Skandal.
Haben Sie übersehen oder nicht sehen wollen, dass genau dieser Brief hinsichtlich der Frage nach Mengeles handschriftlichem Nachlass und dessen Vermarktung eine lange und äußerst fragwürdige (Auktions-)Geschichte hat?
Bei folgenden Auktionen stand dieser Brief in den letzten Jahren bereits zum Verkauf:
Nate D. Sanders Auctions, Los Angeles, Auktionskatalog der Auktion vom 18. Oktober 2010, Nr. 143 und der Auktion vom 6. Februar 2013, Nr. 1108; Regency Superior Auctions, Saint Louis, Los Angeles, Auktionskatalog der Auktion vom 24. Mai 2013, Nr. 826 (verkauft bei einem Zuschlag von US-$ 4.000,--); zuletzt angeboten vom Berliner Militaria-"Auktionshaus für Geschichte", Auktion 95 vom 2. März 2014, Nr. 2286; der Brief blieb dort bei einem Katalogpreis von EUR 3.700,-- unverkauft.
Es sind, jüngsten Recherchen zufolge, die Sie offenbar im Vorfeld der Auktion nicht zur Kenntnis genommen haben, insgesamt 11 Briefe und Karten Mengeles an seine Frau Irene in den letzten 5 Jahren bei Auktionen in den USA und Großbritannien versteigert worden, darunter auch der jetzt bei Ihnen zur Versteigerung kommende von 1942 nach Freiburg. Die Provenienzgeschichte derselben blieb bislang völlig ungeklärt; Anbieter wie auch neue Besitzer blieben, wie üblich, jeweils anonym.
Die Feldpostbriefe Mengeles, auch der von Ihnen nun ausgerufene und "geschätzte", wurden im Rahmen eines Aufsatzes vollständig transkribiert, kommentiert und die Nachlassproblematik dabei eigens thematisiert; nachzulesen in:
Markus Wolter: Der SS-Arzt Josef Mengele zwischen Freiburg und Auschwitz – Ein örtlicher Beitrag zum Banalen und Bösen. In: „Schau-ins-Land“, Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins. 133. Jahrbuch 2014, Freiburg (2015), S. 149-189.
Ich bitte um gelegentliche Stellungnahme in dieser Sache.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Wolter
Freiburg
Nachbemerkung zur Angebotsbeschreibung:
Dass Peter Kiefer die vergangenen Auktionen und Verkäufe/Verkaufsversuche des Mengele-Briefes zumindest teilweise nicht unbekannt waren, belegt die unveränderte und vollständige Übernahme der - englischsprachigen - Angaben zu Briefinhalt und Briefautor aus der letzten amerikanischen Auktion 2013, einschließlich deren Fehler; und ohne dies als Zitat ordentlich auszuweisen.
Vgl.: https://regencystamps.com/1942-josef-mengele-handwritten-letter-to-his-wife--lot306375.aspx
Mit der Festlegung und Vervielfachung des "Schätzpreises" auf EUR 12.000,-- diskreditiert sich das Auktionshaus vor diesem Hintergrund vollends und lässt die gebotene Sorgfaltspflicht und Seriosität vermissen.
Die gewünschte Stellungnahme zur oben formulierten Kritik blieb bislang aus.
Vgl.: Bericht in der "Pforzheimer Zeitung" vom 25. April 2015:
https://www.pz-news.de/kultur_artikel,-Versteigerung-von-Mengele-Brief-in-Pforzheim-stoesst-auf-Kritik-_arid,1017722.html
Markus Wolter, 25. April 2015
__________
"Verbrannt"
Immerhin: mit dem Mengele-Brief war das erhoffte Geschäft nicht zu machen; über die Gründe kann nur spekuliert werden. Das "Los" fand zum Ausrufpreis bei der gestrigen Auktion keinen Bieter. Einsichtig, konsequent und begrüßenswert wäre es, wenn der "Artikel" jetzt auch noch aus der Angebotsliste der Rückgänge ("Rückpreis": EUR 12.000,--) entfernt werden könnte.
Markus Wolter, 26. April 2015
Angebot über das Antiquariatsportal ZVAB - Zum Festpreis von 15.360,-- Euro!
Nachdem der Auktionator und Antiquar Peter Kiefer den Mengele-Brief bei seiner Auktion zum Ausrufpreis von EUR 8.000,-- nicht verkaufen konnte, bietet er ihn nun wie selbstverständlich zum Festpreis von EUR 15.360,-- (!) über das Antiquariatsportal ZVAB an:
>>> https://www.zvab.com/basicSearch.do?anyWords=letter+mengele&author=&title=&check_sn=on
Ob als neuer Besitzer oder nach wie vor im Auftrag des anonymen Einlieferers, ist unklar. Der jetzige Angebotspreis ergibt sich jedenfalls rein rechnerisch aus dem angeblich vom Einlieferer vorgegebenen "Schätzpreis" (EUR 12.000),--, erhöht um die Auktionsprovision des Pforzheimer Antiquariats plus Mehrwertsteuer.
Markus Wolter, 20. Juni 2015
mit obszönen, "geschätzten" EUR 12.000,-- und unbedarften Angaben zu Josef Mengele ("Mediziner und Anthropologe") wird in der kommenden Auktion des Pforzheimer Buchauktionshauses Peter Kiefer (25.4.2015) ein Privatbrief des SS-Arztes "ausgerufen":
https://www.kiefer.de/auktion_artikel_details.aspx?KatNr=4124&Auktion=92.
Unbekannt ist dieser Brief nicht: Seit 2010 stand er bereits bei vier verschiedenen Auktionen in den USA und zuletzt 2014 in Berlin zum Verkauf. Nun also, am Ende einer fragwürdigen Preissteigerungskurve und mit ungeklärter Provenienz, wird der Brief mutmaßlich abermals in unbekanntem Privatbesitz verschwinden und nicht in einem seriösen Archiv gesichert überliefert.
Dass sowohl der anonyme "Einlieferer" und Besitzer als auch das Auktionshaus Kiefer keine Skrupel haben, den aktuellen "Marktwert" solcher NS-Devotionalien auszuloten, hochzutreiben und die Provisionen einzustreichen, versteht sich bedauerlicherweise von selbst. Und wieder wird an zeitgeschichtlichen Archiven vorbei schnelles Geld mit solchen NS-Dokumenten gemacht; unbekannt, in wessen Hände sie kommen und was mit ihnen geschieht.
________
Offener Brief an das Auktionshaus Peter Kiefer, Pforzheim, 16.4.2015:
Sehr geehrter Herr Kiefer,
dass Sie mit solchen Dokumenten unbedacht und offenkundig ohne Bedenken nun auch Ihr Haus zu einem unseriösen Marktplatz des NS-Devotionalienhandels machen, ist, milde gesagt, bedauerlich; tatsächlich ist es ein Skandal.
Haben Sie übersehen oder nicht sehen wollen, dass genau dieser Brief hinsichtlich der Frage nach Mengeles handschriftlichem Nachlass und dessen Vermarktung eine lange und äußerst fragwürdige (Auktions-)Geschichte hat?
Bei folgenden Auktionen stand dieser Brief in den letzten Jahren bereits zum Verkauf:
Nate D. Sanders Auctions, Los Angeles, Auktionskatalog der Auktion vom 18. Oktober 2010, Nr. 143 und der Auktion vom 6. Februar 2013, Nr. 1108; Regency Superior Auctions, Saint Louis, Los Angeles, Auktionskatalog der Auktion vom 24. Mai 2013, Nr. 826 (verkauft bei einem Zuschlag von US-$ 4.000,--); zuletzt angeboten vom Berliner Militaria-"Auktionshaus für Geschichte", Auktion 95 vom 2. März 2014, Nr. 2286; der Brief blieb dort bei einem Katalogpreis von EUR 3.700,-- unverkauft.
Es sind, jüngsten Recherchen zufolge, die Sie offenbar im Vorfeld der Auktion nicht zur Kenntnis genommen haben, insgesamt 11 Briefe und Karten Mengeles an seine Frau Irene in den letzten 5 Jahren bei Auktionen in den USA und Großbritannien versteigert worden, darunter auch der jetzt bei Ihnen zur Versteigerung kommende von 1942 nach Freiburg. Die Provenienzgeschichte derselben blieb bislang völlig ungeklärt; Anbieter wie auch neue Besitzer blieben, wie üblich, jeweils anonym.
Die Feldpostbriefe Mengeles, auch der von Ihnen nun ausgerufene und "geschätzte", wurden im Rahmen eines Aufsatzes vollständig transkribiert, kommentiert und die Nachlassproblematik dabei eigens thematisiert; nachzulesen in:
Markus Wolter: Der SS-Arzt Josef Mengele zwischen Freiburg und Auschwitz – Ein örtlicher Beitrag zum Banalen und Bösen. In: „Schau-ins-Land“, Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins. 133. Jahrbuch 2014, Freiburg (2015), S. 149-189.
Ich bitte um gelegentliche Stellungnahme in dieser Sache.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Wolter
Freiburg
Nachbemerkung zur Angebotsbeschreibung:
Dass Peter Kiefer die vergangenen Auktionen und Verkäufe/Verkaufsversuche des Mengele-Briefes zumindest teilweise nicht unbekannt waren, belegt die unveränderte und vollständige Übernahme der - englischsprachigen - Angaben zu Briefinhalt und Briefautor aus der letzten amerikanischen Auktion 2013, einschließlich deren Fehler; und ohne dies als Zitat ordentlich auszuweisen.
Vgl.: https://regencystamps.com/1942-josef-mengele-handwritten-letter-to-his-wife--lot306375.aspx
Mit der Festlegung und Vervielfachung des "Schätzpreises" auf EUR 12.000,-- diskreditiert sich das Auktionshaus vor diesem Hintergrund vollends und lässt die gebotene Sorgfaltspflicht und Seriosität vermissen.
Die gewünschte Stellungnahme zur oben formulierten Kritik blieb bislang aus.
Vgl.: Bericht in der "Pforzheimer Zeitung" vom 25. April 2015:
https://www.pz-news.de/kultur_artikel,-Versteigerung-von-Mengele-Brief-in-Pforzheim-stoesst-auf-Kritik-_arid,1017722.html
Markus Wolter, 25. April 2015
__________
"Verbrannt"
Immerhin: mit dem Mengele-Brief war das erhoffte Geschäft nicht zu machen; über die Gründe kann nur spekuliert werden. Das "Los" fand zum Ausrufpreis bei der gestrigen Auktion keinen Bieter. Einsichtig, konsequent und begrüßenswert wäre es, wenn der "Artikel" jetzt auch noch aus der Angebotsliste der Rückgänge ("Rückpreis": EUR 12.000,--) entfernt werden könnte.
Markus Wolter, 26. April 2015
Angebot über das Antiquariatsportal ZVAB - Zum Festpreis von 15.360,-- Euro!
Nachdem der Auktionator und Antiquar Peter Kiefer den Mengele-Brief bei seiner Auktion zum Ausrufpreis von EUR 8.000,-- nicht verkaufen konnte, bietet er ihn nun wie selbstverständlich zum Festpreis von EUR 15.360,-- (!) über das Antiquariatsportal ZVAB an:
>>> https://www.zvab.com/basicSearch.do?anyWords=letter+mengele&author=&title=&check_sn=on
Ob als neuer Besitzer oder nach wie vor im Auftrag des anonymen Einlieferers, ist unklar. Der jetzige Angebotspreis ergibt sich jedenfalls rein rechnerisch aus dem angeblich vom Einlieferer vorgegebenen "Schätzpreis" (EUR 12.000),--, erhöht um die Auktionsprovision des Pforzheimer Antiquariats plus Mehrwertsteuer.
Markus Wolter, 20. Juni 2015
deep-listening - am Donnerstag, 16. April 2015, 20:06 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"bei der Internationalen Ordensarchivtagung, die das Referat für die Kulturgüter der Orden vom 13. bis 15. April 2015 in Schloß Puchberg in Wels ausgerichtet hat, fand am Montag eine Podiumsdiskussion über Zukunftsfragen, Trends und Visionen im Archivwesen statt. Es diskutierten Irmgard Christa Becker (Archivschule Marburg), Heinrich Berg (Wiener Stadt- und Landesarchiv) und Peter Pfister (Archiv des Erzbistums München und Freising), es moderierte Helga Penz.
Hier gibt es das Video dazu:
https://kulturgueter.kath-orden.at/termine-service/podiumsdiskussion-zu-zukunftsfragen-im-archivwesen
oder direkt zu youtube:
https://youtu.be/OQVcuip0HiI "
Hier gibt es das Video dazu:
https://kulturgueter.kath-orden.at/termine-service/podiumsdiskussion-zu-zukunftsfragen-im-archivwesen
oder direkt zu youtube:
https://youtu.be/OQVcuip0HiI "
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 19:07 - Rubrik: Archive in der Zukunft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Um das berühmte Dokument begann in Israel ein Prozess.
Von Hagen Jung
"Seit 1999 wird 'Schindlers Liste', die 1200 Juden vor der Ermordung rettete, in Jerusalem aufbewahrt. Am Dienstag begann dort ein Prozess um das Dokument. Eine Erbin von Oskar Schindlers Witwe will es haben."
https://www.neues-deutschland.de/artikel/968021.wem-gehoert-schindlers-liste.html
Es handelt sich eine Kopie der Liste, die Schindler in einem Koffer aufbewahrt hatte. Sie befindet sich im Besitz von Yad Vashem.
Eine weitere Originalkopie soll 2009 in Australien gefunden worden sein:
https://archiv.twoday.net/stories/5631613/
Von Hagen Jung
"Seit 1999 wird 'Schindlers Liste', die 1200 Juden vor der Ermordung rettete, in Jerusalem aufbewahrt. Am Dienstag begann dort ein Prozess um das Dokument. Eine Erbin von Oskar Schindlers Witwe will es haben."
https://www.neues-deutschland.de/artikel/968021.wem-gehoert-schindlers-liste.html
Es handelt sich eine Kopie der Liste, die Schindler in einem Koffer aufbewahrt hatte. Sie befindet sich im Besitz von Yad Vashem.
Eine weitere Originalkopie soll 2009 in Australien gefunden worden sein:
https://archiv.twoday.net/stories/5631613/
IngridStrauch - am Donnerstag, 16. April 2015, 18:22 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.gfh-biberach.de/archiv/
PDFs, die alten Adressen funktionieren nicht mehr:
https://archiv.twoday.net/stories/6118539/
Update:
https://archiv.twoday.net/stories/1022464189/
#histverein
PDFs, die alten Adressen funktionieren nicht mehr:
https://archiv.twoday.net/stories/6118539/
Update:
https://archiv.twoday.net/stories/1022464189/
#histverein
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 17:45 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nach der EuGH-Entscheidung im Herbst letzten Jahres
https://archiv.twoday.net/stories/985928895/
war klar, dass die Verlage Bibliotheken die Digitalisierung nach § 52b UrhG nicht verbieten können. In Deutschland dürfen Nutzer sogar elektronische Kopien anfertigen, so die Pressemeldung zur jetzt ergangenen BGH-Entscheidung.
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2015&Sort=3&nr=70808&pos=0&anz=64
Dass die Klägerin der Beklagten den Abschluss eines Lizenzvertrages angeboten hat, der die Beklagte dazu berechtigt hätte, im Verlag der Klägerin erschienene Bücher in digitalisierter Form an den elektronischen Leseplätzen ihrer Bibliothek zugänglich zu machen, hat die Beklagte rechtlich nicht daran gehindert, diese Bücher unter Berufung auf § 52b UrhG auch ohne Einwilligung der Klägerin auf diese Weise zu nutzen. Unter "vertraglichen Regelungen", die nach § 52b UrhG einer solchen Nutzung entgegenstehen, sind allein Regelungen in bestehenden Verträgen und keine bloßen Vertragsangebote zu verstehen.
Die Beklagte ist auch berechtigt, im Verlag der Klägerin erschienene Bücher ihres Bibliotheksbestandes zu digitalisieren, wenn dies erforderlich ist, um diese Bücher an elektronischen Leseplätzen ihrer Bibliothek zugänglich zu machen. § 52b UrhG sieht zwar keine solche Berechtigung vor. Jedoch ist in diesen Fällen die unmittelbar für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken in Unterricht und Forschung geltende Regelung des § 52a Abs. 3 UrhG entsprechend anwendbar, die zur Zugänglichmachung erforderliche Vervielfältigungen erlaubt. Eine entsprechende Anwendung dieser Regelung ist geboten, weil das Recht zur Wiedergabe von Werken an elektronischen Leseplätzen einen großen Teil seines sachlichen Gehalts und sogar seiner praktischen Wirksamkeit verlieren würde, wenn die Bibliotheken kein akzessorisches Recht zur Digitalisierung der betroffenen Werke besäßen.
Die Beklagte hat das Urheberrecht an dem Buch auch nicht dadurch verletzt, dass sie es Bibliotheksnutzern ermöglicht hat, das an elektronischen Leseplätzen zugänglich gemachte Werk auszudrucken oder auf USB-Sticks abzuspeichern. Der Beklagten war es nach § 52b UrhG erlaubt, das Buch an elektronischen Leseplätzen zugänglich zu machen. § 52b UrhG ist im Blick auf Art. 5 Abs. 3 Buchst. n der Richtlinie 2001/29/EG nicht dahingehend einschränkend auszulegen, dass Werke an elektronischen Leseplätzen nur in der Weise zugänglich gemacht werden dürfen, dass sie von Nutzern dort nur gelesen und nicht auch ausgedruckt oder abgespeichert werden können. Die Beklagte haftet auch nicht für unbefugte Vervielfältigungen des Werkes durch Nutzer der elektronischen Leseplätze. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass es zu unberechtigten Vervielfältigungen durch Nutzer der Leseplätze gekommen ist. Davon kann auch nicht ohne weiteres ausgegangen werden. Ein Ausdrucken oder Abspeichern von an elektronischen Leseplätzen bereitgestellten Werken kann in vielen Fällen als Vervielfältigung zum privaten oder sonstigen eigenen Gebrauch nach § 53 UrhG zulässig sein.
Urteil vom 16. April 2015 - I ZR 69/11 - Elektronische Leseplätze II
https://archiv.twoday.net/search?q=lesepl%C3%A4tze
https://archiv.twoday.net/stories/985928895/
war klar, dass die Verlage Bibliotheken die Digitalisierung nach § 52b UrhG nicht verbieten können. In Deutschland dürfen Nutzer sogar elektronische Kopien anfertigen, so die Pressemeldung zur jetzt ergangenen BGH-Entscheidung.
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2015&Sort=3&nr=70808&pos=0&anz=64
Dass die Klägerin der Beklagten den Abschluss eines Lizenzvertrages angeboten hat, der die Beklagte dazu berechtigt hätte, im Verlag der Klägerin erschienene Bücher in digitalisierter Form an den elektronischen Leseplätzen ihrer Bibliothek zugänglich zu machen, hat die Beklagte rechtlich nicht daran gehindert, diese Bücher unter Berufung auf § 52b UrhG auch ohne Einwilligung der Klägerin auf diese Weise zu nutzen. Unter "vertraglichen Regelungen", die nach § 52b UrhG einer solchen Nutzung entgegenstehen, sind allein Regelungen in bestehenden Verträgen und keine bloßen Vertragsangebote zu verstehen.
Die Beklagte ist auch berechtigt, im Verlag der Klägerin erschienene Bücher ihres Bibliotheksbestandes zu digitalisieren, wenn dies erforderlich ist, um diese Bücher an elektronischen Leseplätzen ihrer Bibliothek zugänglich zu machen. § 52b UrhG sieht zwar keine solche Berechtigung vor. Jedoch ist in diesen Fällen die unmittelbar für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken in Unterricht und Forschung geltende Regelung des § 52a Abs. 3 UrhG entsprechend anwendbar, die zur Zugänglichmachung erforderliche Vervielfältigungen erlaubt. Eine entsprechende Anwendung dieser Regelung ist geboten, weil das Recht zur Wiedergabe von Werken an elektronischen Leseplätzen einen großen Teil seines sachlichen Gehalts und sogar seiner praktischen Wirksamkeit verlieren würde, wenn die Bibliotheken kein akzessorisches Recht zur Digitalisierung der betroffenen Werke besäßen.
Die Beklagte hat das Urheberrecht an dem Buch auch nicht dadurch verletzt, dass sie es Bibliotheksnutzern ermöglicht hat, das an elektronischen Leseplätzen zugänglich gemachte Werk auszudrucken oder auf USB-Sticks abzuspeichern. Der Beklagten war es nach § 52b UrhG erlaubt, das Buch an elektronischen Leseplätzen zugänglich zu machen. § 52b UrhG ist im Blick auf Art. 5 Abs. 3 Buchst. n der Richtlinie 2001/29/EG nicht dahingehend einschränkend auszulegen, dass Werke an elektronischen Leseplätzen nur in der Weise zugänglich gemacht werden dürfen, dass sie von Nutzern dort nur gelesen und nicht auch ausgedruckt oder abgespeichert werden können. Die Beklagte haftet auch nicht für unbefugte Vervielfältigungen des Werkes durch Nutzer der elektronischen Leseplätze. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass es zu unberechtigten Vervielfältigungen durch Nutzer der Leseplätze gekommen ist. Davon kann auch nicht ohne weiteres ausgegangen werden. Ein Ausdrucken oder Abspeichern von an elektronischen Leseplätzen bereitgestellten Werken kann in vielen Fällen als Vervielfältigung zum privaten oder sonstigen eigenen Gebrauch nach § 53 UrhG zulässig sein.
Urteil vom 16. April 2015 - I ZR 69/11 - Elektronische Leseplätze II
https://archiv.twoday.net/search?q=lesepl%C3%A4tze
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 17:16 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2015/04/16/thecontentmine-is-ready-for-business-and-will-make-scientific-and-medical-facts-available-to-everyone-on-a-massive-scale/
https://contentmine.org/
https://contentmine.org/
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 17:11 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.tandfonline.com/toc/wjao20/current#.VS_N7fmsXHt
Abzocke matters: Ein Artikel kostet 30 Euro, das ganze Heft 117 Euro. Wieso bitteschön muss eine archivalische Fachzeitschrift bei einem sündteuren Verlag (statt Open Access) erscheinen, damit sich ja niemand die Beiträge leisten kann?
Abzocke matters: Ein Artikel kostet 30 Euro, das ganze Heft 117 Euro. Wieso bitteschön muss eine archivalische Fachzeitschrift bei einem sündteuren Verlag (statt Open Access) erscheinen, damit sich ja niemand die Beiträge leisten kann?
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 16:58 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://oldenburger-onlinezeitung.de/lokal/paul-raabe-archiv-eroeffnet-45951
https://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg55344.html
https://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg55344.html
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 16:07 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wenn der Burgerbibliothek-Vermerk aber wichtige Informationen abdeckt, ist das unschön.
https://katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=129656

https://katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=129656
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 15:35 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein umfangreiches PDF enthält Nachweise zur Wappenführung im Kanton Zürich.
https://www.staatsarchiv.zh.ch/internet/justiz_inneres/sta/de/recherche1/themen/wappennachweiskartei.html
https://www.staatsarchiv.zh.ch/internet/justiz_inneres/sta/de/recherche1/themen/wappennachweiskartei.html
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 15:27 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.badische-zeitung.de/sportpolitik/doping-akten-wurden-versteckt-einige-sind-verschollen--102997976.html
Fredy Stober, der Mitbegründer des Badischen Sportbunds und langjährige Präsident des Skiverbands Schwarzwald, starb 2010 im Alter von 100 Jahren. Er war der Patriarch des Sports in der Region, kannte dessen Geschichte wie kein Zweiter – und er legte sein eigenes, privates Archiv an. In seinem Büro im zweiten Stock seines Hauses in Freiburg lagerte er Dutzende von Aktenordnern, darunter drei mit der Aufschrift "Doping". Einige Monate vor seinem Tod regelte Stober seinen Nachlass und vereinbarte mit dem Staatsarchiv, Außenstelle Freiburg, dass seine wichtigsten Unterlagen in das Archiv überführt werden sollten.
Insgesamt ging es um rund 40 Ordner. Aber nicht alle kamen nach Stobers Tod im Staatsarchiv an. Die drei Ordner mit der Aufschrift "Doping" fehlten. Das bestätigt ein Mitglied der Untersuchungskommission der BZ. Die Ordner sind bis heute verschollen. Das Staatsarchiv war für die Überführung nicht verantwortlich.
Fredy Stober, der Mitbegründer des Badischen Sportbunds und langjährige Präsident des Skiverbands Schwarzwald, starb 2010 im Alter von 100 Jahren. Er war der Patriarch des Sports in der Region, kannte dessen Geschichte wie kein Zweiter – und er legte sein eigenes, privates Archiv an. In seinem Büro im zweiten Stock seines Hauses in Freiburg lagerte er Dutzende von Aktenordnern, darunter drei mit der Aufschrift "Doping". Einige Monate vor seinem Tod regelte Stober seinen Nachlass und vereinbarte mit dem Staatsarchiv, Außenstelle Freiburg, dass seine wichtigsten Unterlagen in das Archiv überführt werden sollten.
Insgesamt ging es um rund 40 Ordner. Aber nicht alle kamen nach Stobers Tod im Staatsarchiv an. Die drei Ordner mit der Aufschrift "Doping" fehlten. Das bestätigt ein Mitglied der Untersuchungskommission der BZ. Die Ordner sind bis heute verschollen. Das Staatsarchiv war für die Überführung nicht verantwortlich.
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 15:21 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.deutschlandfunk.de/nationalsozialismus-in-norwegen-akteneinsicht-und-die-frage.795.de.html?dram:article_id=316541
"In einem Kellerraum des norwegischen Staatsarchives in Oslo lagern die Akten von NS-Verbrechern, Kollaborateuren und Mitläufern. 70 Jahre lang waren die Unterlagen nur Forschern und Behörden zugänglich. Seit dem 1. Januar stehen sie allen Norwegern offen – ein Antrag auf Einsicht genügt."
"In einem Kellerraum des norwegischen Staatsarchives in Oslo lagern die Akten von NS-Verbrechern, Kollaborateuren und Mitläufern. 70 Jahre lang waren die Unterlagen nur Forschern und Behörden zugänglich. Seit dem 1. Januar stehen sie allen Norwegern offen – ein Antrag auf Einsicht genügt."
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 15:18 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=36296
„Soweit ich weiß, hat die Loos-Forschung erstmals um 2006 gezielt im Wiener Stadt- und Landesarchiv gesucht, wo sich der Akt damals definitiv befinden hätte müssen, aber man hat keine Spur davon gefunden“, erzählt Andreas Weigel den Hergang. Auch in anderen Archiven und Nachlässen von Loos Freundes- und Bekanntenkreis fanden die Forscher nichts.
Dann aber wurde Weigel Anfang des Vorjahres von einem Antiquar kontaktiert: Er hatte den Akt in der Wiener Wohnung eines soeben verstorbenen ehemaligen Mitarbeiters des Wiener Stadt- und Landesarchivs entdeckt. Außerdem fanden sich dort noch weitere aus dem Archiv entwendete Prozessakten, darunter mehrere zu Lustmord- und Vergewaltigungsfällen.
„Der Akt wurde zwar vor rund fünf Jahrzehnten im Aktenlager des Landesgerichts von Mitarbeitern des Stadt- und Landesarchivs durchgesehen und für die Übernahme ins Archiv vorgemerkt“, weiß Weigel: „Aber kurz vor beziehungsweise im Rahmen der Übernahme muss er auf die Seite geschafft worden sein. Im Wiener Stadt- und Landesarchiv ist er jedenfalls nie eingelangt.“
https://diepresse.com/home/zeitgeschichte/4709389/Loos-Schandtaten-enthullt-vor-der-Welt
Update:
https://archiv.twoday.net/stories/1022431042/
„Soweit ich weiß, hat die Loos-Forschung erstmals um 2006 gezielt im Wiener Stadt- und Landesarchiv gesucht, wo sich der Akt damals definitiv befinden hätte müssen, aber man hat keine Spur davon gefunden“, erzählt Andreas Weigel den Hergang. Auch in anderen Archiven und Nachlässen von Loos Freundes- und Bekanntenkreis fanden die Forscher nichts.
Dann aber wurde Weigel Anfang des Vorjahres von einem Antiquar kontaktiert: Er hatte den Akt in der Wiener Wohnung eines soeben verstorbenen ehemaligen Mitarbeiters des Wiener Stadt- und Landesarchivs entdeckt. Außerdem fanden sich dort noch weitere aus dem Archiv entwendete Prozessakten, darunter mehrere zu Lustmord- und Vergewaltigungsfällen.
„Der Akt wurde zwar vor rund fünf Jahrzehnten im Aktenlager des Landesgerichts von Mitarbeitern des Stadt- und Landesarchivs durchgesehen und für die Übernahme ins Archiv vorgemerkt“, weiß Weigel: „Aber kurz vor beziehungsweise im Rahmen der Übernahme muss er auf die Seite geschafft worden sein. Im Wiener Stadt- und Landesarchiv ist er jedenfalls nie eingelangt.“
https://diepresse.com/home/zeitgeschichte/4709389/Loos-Schandtaten-enthullt-vor-der-Welt
Update:
https://archiv.twoday.net/stories/1022431042/
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 15:08 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 15:06 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 15. April 2015, 21:26 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Peter Koblank hat gerade einen Text über einen Aufsatz von Eduard Hlawitschka veröffentlicht.
https://www.stauferstelen.net/texts/wibald-tabula.htm
"Ein aus dem 12. Jahrhundert überlieferter Stammbaum, Tabula consanguinitatis genannt, der im Zusammenhang mit der 1153 erfolgten Scheidung Friedrichs I. Barbarossa von seiner ersten Ehefrau stehen muss, ist ein Schlüsseldokument für die Stauferforschung. Bis vor kurzem nahm man an, auf Grund dieses Stammbaums habe die Kirche auf Barbarossas Antrag dessen Ehe getrennt. Das ist jedoch ein Irrtum, den der renommierte Historiker Eduard Hlawitschka vor zehn Jahren aufgedeckt hat."
Der Aufsatz von Hlawitschka ist online, wird von Koblank aber nicht verlinkt.
https://www.digizeitschriften.de/link/00121223/0/61/509
In den 1990er Jahren legte ich umfangreiche unveröffentliche Sammlungen zur hochmittelalterlichen Adelsgenealogie des südwestdeutschen Raums an, ausgehend von der Auseinandersetzung mit den Studien von Heinz Bühler und Hansmartin Decker-Hauff. Behandelt habe ich vor allem die Staufer und die Pfalzgrafen von Schwaben, die Besitzgeschichte der Herzöge von Kärnten in Schwaben, Werner von Grüningen., Richwara von Zähringen. Um genealogische Hypothesen zu widerlegen, recherchierte ich nach sogenannten "Nahehen". Außer einigen Andeutungen ist nichts davon publiziert worden.
Einige Hinweise gibt mein Aufsatz von 1995
https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5266/
Dass Josef Heinzelmann 2002 aufgrund meiner Hinweise die Michaelstein-Tradition erörterte, hat mir nicht gefallen.
https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7630/ (Anm. 46)
Harald Drös bezog sich 1997 auf einen mündlichen Hinweis von mir zu Bertha von Boll:
https://www.inschriften.net/landkreis-goeppingen/inschrift/nr/di041-0230.html
Wichtige Studien kamen, ohne meine Überlegungen zu kennen, zu Ergebnissen, die - wie ich - die überbordenden genealogischen Hypothesen in die Schranken wiesen. Die umfangreiche Studie von Tobias Weller zur Heiratspolitik der Staufer (2004), die mir neulich der Autor freundlicherweise als Geschenk verehrte, nahm sich die Spekulationen Decker-Hauffs vor. Eine Zusammenfassung in Form eines Aufsatzes von 2005 ist auch online verfügbar:
https://www.mgh-bibliothek.de//dokumente/a/a139173.pdf
Die Familie der Pfalzgrafen von Schwaben hat der zu früh verstorbene Sönke Lorenz 2009 in der Festschrift für Thomas Zotz kritisch behandelt.
Ganz und gar nicht einverstanden war ich mit der These, Richwara, Gattin Bertholds I. von Zähringen, sei eine Babenbergerin und Tochter Herzog Hermanns IV. gewesen. 2009 hat Eduard Hlawitschka in der ZGO die Abstammung von Hermann IV. zurückgewiesen. Es ist nicht das erste Mal, dass mir die destruktiven Ergebnisse dieses herausragenden Genealogen mehr zusagen als die konstruktiven. Ich bin überhaupt nicht überzeugt, dass die (alternative) Babenberger-Abkunft Richwaras von ihm plausibel gemacht werden konnte.
Da meine eigene Argumentation absolut "wasserdicht" sein sollte, was sich angesichts der unübersichtlichen Quellen- und Literaturlage als schwierig erwies, ist es vielleicht nachvollziehbar, dass ich keine eigene Publikation wagte.
Nicht nur Richwara hat mir Hlawitschka (künftig: H.) "weggenommen", auch seine Studien zu Wibalds Aufstellung zur Verwandtschafts Friedrich Barbarossas mit Adela haben einen Punkt aufgegriffen, auf den ich etliche Jahre vor seinem Aufsatz von 1995 unabhängig von ihm ebenfalls gestoßen war. Die Abbildung unten zeigt meine damalige Aufstellung zu den Nahehen. Zur näheren Datierung meiner Beschäftigung mit diesem Thema dient ein handschriftlicher Brief von Frau Dr. Mechthild Black-Veldtrup, die mir am 6. August 1997 liebenswürdigerweise eine von ihrem Vater angefertigte auszugsweise Übersetzung des Aufsatzes von Gerard Labuda 1963 überließ.
Es ist durchaus bemerkenswert, dass ich zu einem diametral entgegengesetzten Ergebnis als H. kam. Er akzeptierte die Nahehe Barbarossas mit Adela im Verhältnis 4:3, die sich ergibt, wenn man in der Ehefrau Diepolds III. (des Vaters der Adela) von Vohburg eine Tochter des Wladislaw I. Hermann und der Salierin Judith sieht. Dann ist es nur konsequent anzunehmen, dass die Ehe Barbarossas nicht aufgrund Wibalds Zusammenstellung geschieden wurde.
Mein Ansatz resultierte aus der Erwägung, man könne doch aus Nahehen mit aller Vorsicht ein kritisches Schwert schmieden, um den genealogischen Hypothesen-Urwald zu lichten. Bei 4:4 oder 4:3 sollte Skepsis angebracht sein. Da ich nicht an Wibalds Tabula rütteln wollte und sie als Scheidungsbegründung ansah, kam ich zu dem Schluss, dass eine zuverlässige zeitgenössische Quelle (Wibald) in Verbindung mit dem kirchlichen Verbot solcher Nahehen die Hypothese von Diepolds Ehe mit einer Piastin zurückzuweisen in der Lage ist.
Immer wieder haben Nahehen in den berüchtigten genealogischen Kontroversen, in die H. verwickelt war, eine Rolle gespielt. Seine Aussagen 2005 über die Erlaubtheit von Nahehen stimmten nicht mit dem überein, was ich mir aus der Sekundärliteratur angelesen hatte. Schon die Zeitgenossen hatten wohl Probleme mit der Erstreckung des Nahehenverbots. Auf diesen Punkt will ich heute nicht eingehen.
Dass es mir gelingen würde, den kampferprobten Genealogen H. öffentlich zu besiegen, bildete ich mir nicht ein. Hinsichtlich von Quellen- und Literaturkenntnis ihm eindeutig unterlegen, wäre es kaum möglich gewesen, meine (angenommene) methodische Überlegenheit (im Sinne einer größeren Skepsis gegenüber Hypothesen) zur Geltung zu bringen. Wie aussichtslos eine eigene kritische Durchdringung des von H. meisterhaft beherrschten Stoffs war, zeigte meine Lektüre der diversen Arbeiten zu Kuno von Öhningen bzw. zur Konradiner-Genealogie.
Mein eigener Ansatz zu Adela und Friedrich brachte nur eine periphere genealogische Hypothese zum Einsturz, während H. in den Tempel der politischen Geschichte der Stauferzeit vordringen konnte. Sein Ansatz war der interessantere, derjenige mit der größeren Reichweite. Aber ergibt sich daraus automatisch, dass er auch zutreffender ist?
Die Beweislast bei mehreren konkurrierenden Hypothesen liegt meines Erachtens immer bei derjenigen, die die wichtigeren Schlussfolgerungen ermöglicht.
Zu prüfen ist also der Quellenbefund. Diepold von Vohburg war um 1120 mit einer Adelheid verheiratet (H. S. 526f., was sich auch künftig auf den Aufsatz im DA 2005 bezieht), die nach einer Quelle des 15. Jahrhunderts 1127 starb. Von drei Ehen weiß eine genealogische Aufzeichnung des 12. Jahrhunderts aus Ranshofen (im Clm 12631).
https://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_SS_24_S._76
Die Vornamen der Ehefrauen bleiben ungenannt. Die erste soll "de Polonia" gewesen sein. Aus dieser Ehe ging nach der Angabe der Quelle die an erster Stelle genannte Kaiserin Adela hervor. Nach einem Blick auf die Stammtafel der Piasten ist es für H. klar, dass nur eine Tochter von Wladislaw I. Hermann in Betracht kommen kann. Adelheids Geburt setzt er um 1090 an (H. S. 529). Wladislaw nahm (wohl 1088) eine Judith zur zweiten Frau (auch die erste hieß so), die Tochter Kaiser Heinrichs III. Als "entscheidenden Hinweis" wertet H. S. 532 die Angabe des Gallus Anonymus, der über die drei Töchter des Herrschers sagt, dass die ersten einen Russen heiratete, die zweite Nonne wurde (die Äbtissin Agnes von Gandersheim) und die dritte nahm einen Mann "sue gentis", wobei die von H. bevorzugte Lesart, das beziehe sich auf Judith und nicht auf Wladislaw, sich nicht unbedingt aufdrängt.
Halten wir fest: Es gibt keinen Quellenbeleg, dass die polnische Dame, die Diepold von Vohburg heiratete, eine Tochter des Wladislaw war. Selbst wenn man der eher fernliegenden Textinterpretation folgt, dass die dritte Tochter einen Deutschen heiratete, bedeutet das noch nicht, dass Diepold gemeint war. Es ist durchaus anzunehmen, dass es noch andere vornehme Familien in Polen und Deutschland gab, die am Ende des 11. Jahrhunderts Heiratsbündnisse eingehen konnten.
Geht man von der vor H. gültigen Prämisse aus, dass Wibalds Tabula die offizielle Begründung für die Scheidung aufgrund zu naher Verwandtschaft 1153 war, so kann man damit die genealogische Hypothese zurückweisen. Wieso umständlich einen entfernten Verwandtschaftsgrad (kanonischer Grad 6:5) anführen, wenn schon der Grad 4:3 gegeben war!
Was H. dagegen einzuwenden hat, ist eine ad-hoc-Hypothese, die den Quellenanschein hinterfragt: Wibalds Nahehe-Aufstellung sei zwar korrekt, aber nicht die endgültige Version gewesen. Wibald sei zwar ein wichtiger Berater Barbarossas, aber nicht in jedem Punkt informiert gewesen.
Das alles wirkt nun gar nicht überzeugend: Kein wirklich starkes Argument für die Ehe Diepolds mit der Piastin, und dann muss H. auch noch Wibalds Rolle relativieren.
Die Beweislast liegt bei dem, der die etablierte Deutung (Wibalds Aufzeichnung als offizielle Begründung) umstoßen möchte. Dafür braucht es starke Argumente, die H. aber nicht hat. Stattdessen: eine schwach begründete genealogische Hypothese, die sich auf eine Quelle stützt, bei der man einen eigenartigen Bezug "sue gentis" zugrundelegen muss.
Gleichwohl hat H. Zustimmung gefunden. Die Studie von Tobias Küss 2013 zu den Diepoldingern folgt ihm, siehe die Auszüge in Google Books:
https://books.google.de/books?id=JUkjAQAAQBAJ&pg=PA250
Die Interpretation von "sue gentis", die eine polnische Historikerin (Polaczkówna) 1932 vorschlug, habe sich durchzusetzen begonnen, schreibt H. S. 532 Anm. 76 und bezieht sich auf die Edition des Gallus, den Aufsatz von Labuda 1963 und zwei Studien von Black-Veltrup.
Von Labuda habe ich - siehe oben - eine Arbeitsübersetzung. Balzer und andere hätten das Pronomen sue auf Wladislaw bezogen, aber grammatikalisch richtig könne auch der Bezug auf Judith sein, auch wenn man zugeben müsse, dass sich Gallus dann sehr unklar ausgedrückt habe. Als Indizien für die Verheiratung mit einem Deutschen führt Labuda an:
1. Es gebe sonst keine Beispiele für die Ehe einer Piastin mit einem polnischen Magnaten.
2. Es gab keine andere polnische Fürstentochter, die für eine Ehe mit Diepold in Betracht kam.
3. Den Namen Adelheid konnte die Tochter von ihrer Mutter erben (deren Schwester hieß so).
4. Es sei wahrscheinlich, dass Judith nach dem Tod ihres Gatten nach Deutschland zurückkehrte.
Bei 1 und 2 vermerkte Frau Black-Veldtrup auf der mir vorliegenden Kopie der Übersetzung zutreffend a.e.s. (argumentum e silentio). Argument 3 ist nicht zwingend. Angesichts der Ehen slawischer Familien mit deutschen Geschlechtern konnte der Name Adelheid durchaus auch auf andere Weise zur Gattin Diepolds gelangen.
Abgesehen davon, dass der Beweiswert von Argument 4 unklar ist, ist es auch sachlich unzutreffend, wie Black-Veldtrup handschriftlich vermerkte: Judith starb vor Wladislaw. Siehe auch
https://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/salier_2/judith_tochter_von_heinrich_3_1096_salier_arpaden_piasten/judith_koenigin_von_ungarn_+_1096.html
Zwei konkurrierende Hypothesen zu den Ehen Diepolds sind noch kurz zu nennen, bevor ich auf die jüngere polnische Forschung zu sprechen komme.
Da Adela nicht gut älter gewesen sein könne als ihr (um 1122 geborener) Gatte, wies sie Tyroller der zweiten Ehe Diepolds mit Kunigunde (Haus Northeim) zu. Er zitiert durchaus die Ranshofener Genealogie, die ausdrücklich Adela der ersten Ehe zuweist, muss dann aber einen Irrtum angenommen haben. Adela heiße wie ihre Urgroßmutter Adela von Löwen, was aber H. treffend damit kontert, dass Adela ja eine Kurzform von Adelheid sei und so durchaus auf die Mutter zurückverweisen könne.
Labuda stochert im Nebel, wenn er sich Gedanken über die Reihenfolge der Kinder Diepolds macht. Er sieht Adela als jüngstes Kind. Irgendwelche konkreten Anhaltspunkte für das Alter Adelas gibt es nicht. Wenn sich die Ranshofener Notiz tatsächlich geirrt haben sollte, was durchaus nicht auszuschließen ist, dann kann Adela auch der zweiten Ehe Diepolds (nicht vor 1127) entstammen, und dann gibt es selbstverständlich kein Nahehen-Problem über die Salierin Judith!
Hansmartin Decker-Hauff setzte im Stauferkatalog 1977 Nr. 44 Adela, die 1128/29 geboren worden sei, als Tochter der zweiten (nicht der ersten!) Ehe Diepolds an, wobei er aber die übliche Reihenfolge vertauscht: Diepold habe eine Gattin N. von Polen geheiratet, Tochter von König Boleslaus III. Schiefmaul von Polen. Auch hier ergibt sich keine Nahehe, denn Boleslaw entstammt der ersten Ehe seines Vaters mit Judith von Böhmen. Laut Geburtsdatum 1106/9 muss sie der ersten Ehe mit Zbysława entstammen. Würde sie der zweiten entstammen, hätte, vorausgesetzt Bühlers Ansetzung der Adelheid von Mochental aus dem Haus der Diepolder träfe zu, Diepold III. die Enkelin seiner Schwester geheiratet. Aber Decker-Hauff hatte ohnehin seine eigene Theorie zu Adelheid von Mochental, die er Immo Eberl mündlich eröffnete (Ulm und Oberschwaben 1982, S. 30 Anm. 6 und S. 34 Anm. 38). Für ihn war sie eine Stauferin aus der hypothetischen ersten Ehe Herzog Friedrich I. mit einer Beatrix oder Mathilde. Sie heiratete zunächst Heinrich von Berg und dann Diepold von Vohburg (dessen erste Ehefrau Adelheid). Dass der gleichnamige Sohn Heinrichs Bertha von Boll (nach Decker-Hauff und Bühler eine Tochter Friedrichs I.) heiratete, wie Heinz Bühler wollte, kann nicht sein (Nahehe 2:1, Eberl S. 35 Anm. 56a: "kaum möglich").
Vergessen wir diesen ganzen genealogischen Wust Decker-Hauffs rasch wieder!
Unglücklicherweise verfüge ich nicht über polnische Sprachkenntnisse, und Google Translate hilft nur bei E-Texten. Scans in PDFs, Djvus oder in Google Books können nicht direkt übersetzt werden. Aber Fakt ist, dass sich in der polnischen Forschung - und dank des Internets kann ich heute wesentlich einfacher recherchieren als ca. 1997 - eher die Annahme durchsetzt, dass Diepold von Berg KEINE Tochter Wladislaw I. Hermann geheiratet hat.
Szymon Wieczorek schloss sich 2013 dem Zweifel von Kazimierz Jasińskii an, dieser habe anscheinend zu Recht die Hypothese angefochten.
https://books.google.de/books?id=MC7nvfOcXRoC&pg=PA149
Schon in der polnischen Fassung von 1996 hatte er sich so positioniert:
https://rcin.org.pl/Content/2461/WA303_4051_KH103-r1996-R103-nr4_Kwartalnik-Historyczny_02_Wieczorek.pdf
Auch Pac 2013 bezieht sich auf die Frage in einer längeren Fußnote (die ich nicht lesen kann) und die Argumentation von Kazimierz Jasiński.
https://books.google.de/books?id=VlV2BwAAQBAJ&pg=PA258
Zur frühen Genealogie ist in Polen einiges Material online, darunter auch Karteikarten von Kazimierz Jasiński. Siehe auch die Hinweise:
https://historiaimedia.org/2011/09/02/polska-genealogia-dynastyczna-w-internecie/
Hier ist von besonderer Bedeutung ein Aufsatz von Jasiński aus dem Jahr 1989, der einsehbar ist unter
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=164573
Die kritische Argumentation kann ich leider - aus Sprachunkenntnis - nicht nachvollziehen, aber auf S. 61 befindet sich genau jenes Stemma, das mir ca. 1997 auffiel und das H. 2005 als seine Entdeckung vorstellte. Friedrich und Adela im Verhältnis 3:4!
Von daher weiß ich mich in bester Gesellschaft, wenn ich einmal mehr Tobias Weller beipflichte, der 2005, ein Jahr vor H.'s Aufsatz, betonte (Heiratspolitik S. 788): Adelheid, die Gemahlin Diepold III., gelte in der Forschungsliteratur allenthalben als Tochter des Piastenfürsten Wladislaw I. Hermann, "doch findet diese Mutmaßung in den Quellen keinerlei Stütze".
#forschung
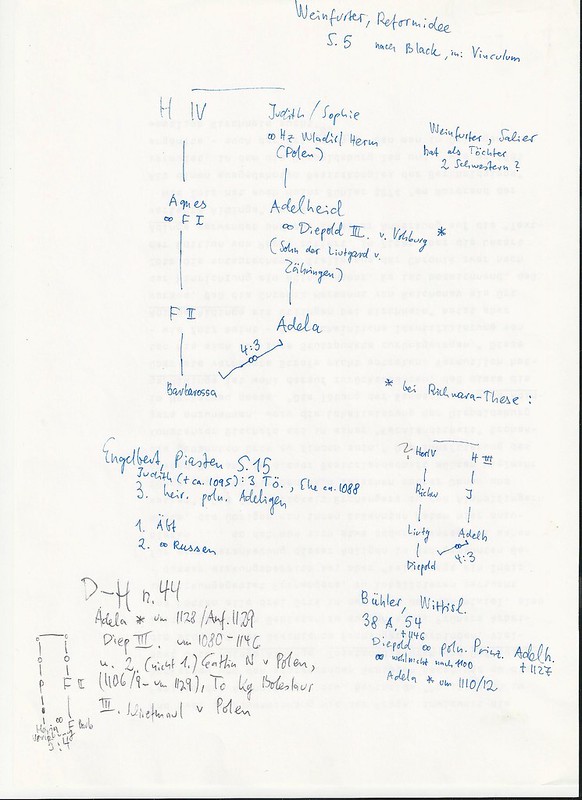
https://www.stauferstelen.net/texts/wibald-tabula.htm
"Ein aus dem 12. Jahrhundert überlieferter Stammbaum, Tabula consanguinitatis genannt, der im Zusammenhang mit der 1153 erfolgten Scheidung Friedrichs I. Barbarossa von seiner ersten Ehefrau stehen muss, ist ein Schlüsseldokument für die Stauferforschung. Bis vor kurzem nahm man an, auf Grund dieses Stammbaums habe die Kirche auf Barbarossas Antrag dessen Ehe getrennt. Das ist jedoch ein Irrtum, den der renommierte Historiker Eduard Hlawitschka vor zehn Jahren aufgedeckt hat."
Der Aufsatz von Hlawitschka ist online, wird von Koblank aber nicht verlinkt.
https://www.digizeitschriften.de/link/00121223/0/61/509
In den 1990er Jahren legte ich umfangreiche unveröffentliche Sammlungen zur hochmittelalterlichen Adelsgenealogie des südwestdeutschen Raums an, ausgehend von der Auseinandersetzung mit den Studien von Heinz Bühler und Hansmartin Decker-Hauff. Behandelt habe ich vor allem die Staufer und die Pfalzgrafen von Schwaben, die Besitzgeschichte der Herzöge von Kärnten in Schwaben, Werner von Grüningen., Richwara von Zähringen. Um genealogische Hypothesen zu widerlegen, recherchierte ich nach sogenannten "Nahehen". Außer einigen Andeutungen ist nichts davon publiziert worden.
Einige Hinweise gibt mein Aufsatz von 1995
https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5266/
Dass Josef Heinzelmann 2002 aufgrund meiner Hinweise die Michaelstein-Tradition erörterte, hat mir nicht gefallen.
https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7630/ (Anm. 46)
Harald Drös bezog sich 1997 auf einen mündlichen Hinweis von mir zu Bertha von Boll:
https://www.inschriften.net/landkreis-goeppingen/inschrift/nr/di041-0230.html
Wichtige Studien kamen, ohne meine Überlegungen zu kennen, zu Ergebnissen, die - wie ich - die überbordenden genealogischen Hypothesen in die Schranken wiesen. Die umfangreiche Studie von Tobias Weller zur Heiratspolitik der Staufer (2004), die mir neulich der Autor freundlicherweise als Geschenk verehrte, nahm sich die Spekulationen Decker-Hauffs vor. Eine Zusammenfassung in Form eines Aufsatzes von 2005 ist auch online verfügbar:
https://www.mgh-bibliothek.de//dokumente/a/a139173.pdf
Die Familie der Pfalzgrafen von Schwaben hat der zu früh verstorbene Sönke Lorenz 2009 in der Festschrift für Thomas Zotz kritisch behandelt.
Ganz und gar nicht einverstanden war ich mit der These, Richwara, Gattin Bertholds I. von Zähringen, sei eine Babenbergerin und Tochter Herzog Hermanns IV. gewesen. 2009 hat Eduard Hlawitschka in der ZGO die Abstammung von Hermann IV. zurückgewiesen. Es ist nicht das erste Mal, dass mir die destruktiven Ergebnisse dieses herausragenden Genealogen mehr zusagen als die konstruktiven. Ich bin überhaupt nicht überzeugt, dass die (alternative) Babenberger-Abkunft Richwaras von ihm plausibel gemacht werden konnte.
Da meine eigene Argumentation absolut "wasserdicht" sein sollte, was sich angesichts der unübersichtlichen Quellen- und Literaturlage als schwierig erwies, ist es vielleicht nachvollziehbar, dass ich keine eigene Publikation wagte.
Nicht nur Richwara hat mir Hlawitschka (künftig: H.) "weggenommen", auch seine Studien zu Wibalds Aufstellung zur Verwandtschafts Friedrich Barbarossas mit Adela haben einen Punkt aufgegriffen, auf den ich etliche Jahre vor seinem Aufsatz von 1995 unabhängig von ihm ebenfalls gestoßen war. Die Abbildung unten zeigt meine damalige Aufstellung zu den Nahehen. Zur näheren Datierung meiner Beschäftigung mit diesem Thema dient ein handschriftlicher Brief von Frau Dr. Mechthild Black-Veldtrup, die mir am 6. August 1997 liebenswürdigerweise eine von ihrem Vater angefertigte auszugsweise Übersetzung des Aufsatzes von Gerard Labuda 1963 überließ.
Es ist durchaus bemerkenswert, dass ich zu einem diametral entgegengesetzten Ergebnis als H. kam. Er akzeptierte die Nahehe Barbarossas mit Adela im Verhältnis 4:3, die sich ergibt, wenn man in der Ehefrau Diepolds III. (des Vaters der Adela) von Vohburg eine Tochter des Wladislaw I. Hermann und der Salierin Judith sieht. Dann ist es nur konsequent anzunehmen, dass die Ehe Barbarossas nicht aufgrund Wibalds Zusammenstellung geschieden wurde.
Mein Ansatz resultierte aus der Erwägung, man könne doch aus Nahehen mit aller Vorsicht ein kritisches Schwert schmieden, um den genealogischen Hypothesen-Urwald zu lichten. Bei 4:4 oder 4:3 sollte Skepsis angebracht sein. Da ich nicht an Wibalds Tabula rütteln wollte und sie als Scheidungsbegründung ansah, kam ich zu dem Schluss, dass eine zuverlässige zeitgenössische Quelle (Wibald) in Verbindung mit dem kirchlichen Verbot solcher Nahehen die Hypothese von Diepolds Ehe mit einer Piastin zurückzuweisen in der Lage ist.
Immer wieder haben Nahehen in den berüchtigten genealogischen Kontroversen, in die H. verwickelt war, eine Rolle gespielt. Seine Aussagen 2005 über die Erlaubtheit von Nahehen stimmten nicht mit dem überein, was ich mir aus der Sekundärliteratur angelesen hatte. Schon die Zeitgenossen hatten wohl Probleme mit der Erstreckung des Nahehenverbots. Auf diesen Punkt will ich heute nicht eingehen.
Dass es mir gelingen würde, den kampferprobten Genealogen H. öffentlich zu besiegen, bildete ich mir nicht ein. Hinsichtlich von Quellen- und Literaturkenntnis ihm eindeutig unterlegen, wäre es kaum möglich gewesen, meine (angenommene) methodische Überlegenheit (im Sinne einer größeren Skepsis gegenüber Hypothesen) zur Geltung zu bringen. Wie aussichtslos eine eigene kritische Durchdringung des von H. meisterhaft beherrschten Stoffs war, zeigte meine Lektüre der diversen Arbeiten zu Kuno von Öhningen bzw. zur Konradiner-Genealogie.
Mein eigener Ansatz zu Adela und Friedrich brachte nur eine periphere genealogische Hypothese zum Einsturz, während H. in den Tempel der politischen Geschichte der Stauferzeit vordringen konnte. Sein Ansatz war der interessantere, derjenige mit der größeren Reichweite. Aber ergibt sich daraus automatisch, dass er auch zutreffender ist?
Die Beweislast bei mehreren konkurrierenden Hypothesen liegt meines Erachtens immer bei derjenigen, die die wichtigeren Schlussfolgerungen ermöglicht.
Zu prüfen ist also der Quellenbefund. Diepold von Vohburg war um 1120 mit einer Adelheid verheiratet (H. S. 526f., was sich auch künftig auf den Aufsatz im DA 2005 bezieht), die nach einer Quelle des 15. Jahrhunderts 1127 starb. Von drei Ehen weiß eine genealogische Aufzeichnung des 12. Jahrhunderts aus Ranshofen (im Clm 12631).
https://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_SS_24_S._76
Die Vornamen der Ehefrauen bleiben ungenannt. Die erste soll "de Polonia" gewesen sein. Aus dieser Ehe ging nach der Angabe der Quelle die an erster Stelle genannte Kaiserin Adela hervor. Nach einem Blick auf die Stammtafel der Piasten ist es für H. klar, dass nur eine Tochter von Wladislaw I. Hermann in Betracht kommen kann. Adelheids Geburt setzt er um 1090 an (H. S. 529). Wladislaw nahm (wohl 1088) eine Judith zur zweiten Frau (auch die erste hieß so), die Tochter Kaiser Heinrichs III. Als "entscheidenden Hinweis" wertet H. S. 532 die Angabe des Gallus Anonymus, der über die drei Töchter des Herrschers sagt, dass die ersten einen Russen heiratete, die zweite Nonne wurde (die Äbtissin Agnes von Gandersheim) und die dritte nahm einen Mann "sue gentis", wobei die von H. bevorzugte Lesart, das beziehe sich auf Judith und nicht auf Wladislaw, sich nicht unbedingt aufdrängt.
Halten wir fest: Es gibt keinen Quellenbeleg, dass die polnische Dame, die Diepold von Vohburg heiratete, eine Tochter des Wladislaw war. Selbst wenn man der eher fernliegenden Textinterpretation folgt, dass die dritte Tochter einen Deutschen heiratete, bedeutet das noch nicht, dass Diepold gemeint war. Es ist durchaus anzunehmen, dass es noch andere vornehme Familien in Polen und Deutschland gab, die am Ende des 11. Jahrhunderts Heiratsbündnisse eingehen konnten.
Geht man von der vor H. gültigen Prämisse aus, dass Wibalds Tabula die offizielle Begründung für die Scheidung aufgrund zu naher Verwandtschaft 1153 war, so kann man damit die genealogische Hypothese zurückweisen. Wieso umständlich einen entfernten Verwandtschaftsgrad (kanonischer Grad 6:5) anführen, wenn schon der Grad 4:3 gegeben war!
Was H. dagegen einzuwenden hat, ist eine ad-hoc-Hypothese, die den Quellenanschein hinterfragt: Wibalds Nahehe-Aufstellung sei zwar korrekt, aber nicht die endgültige Version gewesen. Wibald sei zwar ein wichtiger Berater Barbarossas, aber nicht in jedem Punkt informiert gewesen.
Das alles wirkt nun gar nicht überzeugend: Kein wirklich starkes Argument für die Ehe Diepolds mit der Piastin, und dann muss H. auch noch Wibalds Rolle relativieren.
Die Beweislast liegt bei dem, der die etablierte Deutung (Wibalds Aufzeichnung als offizielle Begründung) umstoßen möchte. Dafür braucht es starke Argumente, die H. aber nicht hat. Stattdessen: eine schwach begründete genealogische Hypothese, die sich auf eine Quelle stützt, bei der man einen eigenartigen Bezug "sue gentis" zugrundelegen muss.
Gleichwohl hat H. Zustimmung gefunden. Die Studie von Tobias Küss 2013 zu den Diepoldingern folgt ihm, siehe die Auszüge in Google Books:
https://books.google.de/books?id=JUkjAQAAQBAJ&pg=PA250
Die Interpretation von "sue gentis", die eine polnische Historikerin (Polaczkówna) 1932 vorschlug, habe sich durchzusetzen begonnen, schreibt H. S. 532 Anm. 76 und bezieht sich auf die Edition des Gallus, den Aufsatz von Labuda 1963 und zwei Studien von Black-Veltrup.
Von Labuda habe ich - siehe oben - eine Arbeitsübersetzung. Balzer und andere hätten das Pronomen sue auf Wladislaw bezogen, aber grammatikalisch richtig könne auch der Bezug auf Judith sein, auch wenn man zugeben müsse, dass sich Gallus dann sehr unklar ausgedrückt habe. Als Indizien für die Verheiratung mit einem Deutschen führt Labuda an:
1. Es gebe sonst keine Beispiele für die Ehe einer Piastin mit einem polnischen Magnaten.
2. Es gab keine andere polnische Fürstentochter, die für eine Ehe mit Diepold in Betracht kam.
3. Den Namen Adelheid konnte die Tochter von ihrer Mutter erben (deren Schwester hieß so).
4. Es sei wahrscheinlich, dass Judith nach dem Tod ihres Gatten nach Deutschland zurückkehrte.
Bei 1 und 2 vermerkte Frau Black-Veldtrup auf der mir vorliegenden Kopie der Übersetzung zutreffend a.e.s. (argumentum e silentio). Argument 3 ist nicht zwingend. Angesichts der Ehen slawischer Familien mit deutschen Geschlechtern konnte der Name Adelheid durchaus auch auf andere Weise zur Gattin Diepolds gelangen.
Abgesehen davon, dass der Beweiswert von Argument 4 unklar ist, ist es auch sachlich unzutreffend, wie Black-Veldtrup handschriftlich vermerkte: Judith starb vor Wladislaw. Siehe auch
https://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/salier_2/judith_tochter_von_heinrich_3_1096_salier_arpaden_piasten/judith_koenigin_von_ungarn_+_1096.html
Zwei konkurrierende Hypothesen zu den Ehen Diepolds sind noch kurz zu nennen, bevor ich auf die jüngere polnische Forschung zu sprechen komme.
Da Adela nicht gut älter gewesen sein könne als ihr (um 1122 geborener) Gatte, wies sie Tyroller der zweiten Ehe Diepolds mit Kunigunde (Haus Northeim) zu. Er zitiert durchaus die Ranshofener Genealogie, die ausdrücklich Adela der ersten Ehe zuweist, muss dann aber einen Irrtum angenommen haben. Adela heiße wie ihre Urgroßmutter Adela von Löwen, was aber H. treffend damit kontert, dass Adela ja eine Kurzform von Adelheid sei und so durchaus auf die Mutter zurückverweisen könne.
Labuda stochert im Nebel, wenn er sich Gedanken über die Reihenfolge der Kinder Diepolds macht. Er sieht Adela als jüngstes Kind. Irgendwelche konkreten Anhaltspunkte für das Alter Adelas gibt es nicht. Wenn sich die Ranshofener Notiz tatsächlich geirrt haben sollte, was durchaus nicht auszuschließen ist, dann kann Adela auch der zweiten Ehe Diepolds (nicht vor 1127) entstammen, und dann gibt es selbstverständlich kein Nahehen-Problem über die Salierin Judith!
Hansmartin Decker-Hauff setzte im Stauferkatalog 1977 Nr. 44 Adela, die 1128/29 geboren worden sei, als Tochter der zweiten (nicht der ersten!) Ehe Diepolds an, wobei er aber die übliche Reihenfolge vertauscht: Diepold habe eine Gattin N. von Polen geheiratet, Tochter von König Boleslaus III. Schiefmaul von Polen. Auch hier ergibt sich keine Nahehe, denn Boleslaw entstammt der ersten Ehe seines Vaters mit Judith von Böhmen. Laut Geburtsdatum 1106/9 muss sie der ersten Ehe mit Zbysława entstammen. Würde sie der zweiten entstammen, hätte, vorausgesetzt Bühlers Ansetzung der Adelheid von Mochental aus dem Haus der Diepolder träfe zu, Diepold III. die Enkelin seiner Schwester geheiratet. Aber Decker-Hauff hatte ohnehin seine eigene Theorie zu Adelheid von Mochental, die er Immo Eberl mündlich eröffnete (Ulm und Oberschwaben 1982, S. 30 Anm. 6 und S. 34 Anm. 38). Für ihn war sie eine Stauferin aus der hypothetischen ersten Ehe Herzog Friedrich I. mit einer Beatrix oder Mathilde. Sie heiratete zunächst Heinrich von Berg und dann Diepold von Vohburg (dessen erste Ehefrau Adelheid). Dass der gleichnamige Sohn Heinrichs Bertha von Boll (nach Decker-Hauff und Bühler eine Tochter Friedrichs I.) heiratete, wie Heinz Bühler wollte, kann nicht sein (Nahehe 2:1, Eberl S. 35 Anm. 56a: "kaum möglich").
Vergessen wir diesen ganzen genealogischen Wust Decker-Hauffs rasch wieder!
Unglücklicherweise verfüge ich nicht über polnische Sprachkenntnisse, und Google Translate hilft nur bei E-Texten. Scans in PDFs, Djvus oder in Google Books können nicht direkt übersetzt werden. Aber Fakt ist, dass sich in der polnischen Forschung - und dank des Internets kann ich heute wesentlich einfacher recherchieren als ca. 1997 - eher die Annahme durchsetzt, dass Diepold von Berg KEINE Tochter Wladislaw I. Hermann geheiratet hat.
Szymon Wieczorek schloss sich 2013 dem Zweifel von Kazimierz Jasińskii an, dieser habe anscheinend zu Recht die Hypothese angefochten.
https://books.google.de/books?id=MC7nvfOcXRoC&pg=PA149
Schon in der polnischen Fassung von 1996 hatte er sich so positioniert:
https://rcin.org.pl/Content/2461/WA303_4051_KH103-r1996-R103-nr4_Kwartalnik-Historyczny_02_Wieczorek.pdf
Auch Pac 2013 bezieht sich auf die Frage in einer längeren Fußnote (die ich nicht lesen kann) und die Argumentation von Kazimierz Jasiński.
https://books.google.de/books?id=VlV2BwAAQBAJ&pg=PA258
Zur frühen Genealogie ist in Polen einiges Material online, darunter auch Karteikarten von Kazimierz Jasiński. Siehe auch die Hinweise:
https://historiaimedia.org/2011/09/02/polska-genealogia-dynastyczna-w-internecie/
Hier ist von besonderer Bedeutung ein Aufsatz von Jasiński aus dem Jahr 1989, der einsehbar ist unter
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=164573
Die kritische Argumentation kann ich leider - aus Sprachunkenntnis - nicht nachvollziehen, aber auf S. 61 befindet sich genau jenes Stemma, das mir ca. 1997 auffiel und das H. 2005 als seine Entdeckung vorstellte. Friedrich und Adela im Verhältnis 3:4!
Von daher weiß ich mich in bester Gesellschaft, wenn ich einmal mehr Tobias Weller beipflichte, der 2005, ein Jahr vor H.'s Aufsatz, betonte (Heiratspolitik S. 788): Adelheid, die Gemahlin Diepold III., gelte in der Forschungsliteratur allenthalben als Tochter des Piastenfürsten Wladislaw I. Hermann, "doch findet diese Mutmaßung in den Quellen keinerlei Stütze".
#forschung
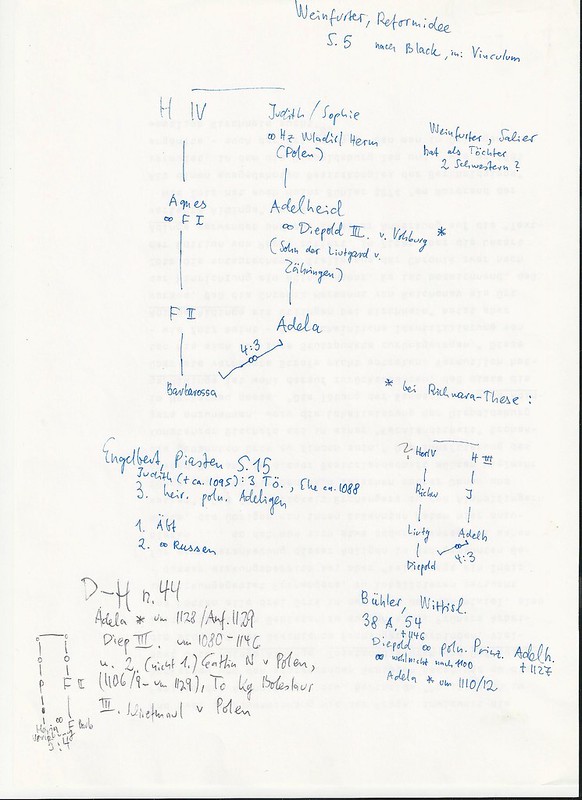
KlausGraf - am Mittwoch, 15. April 2015, 17:02 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
Das umfangreiche Katalogbuch von 2011 steht online zur Verfügung unter:
https://www.landesarchiv-bw.de/web/57834
Rezensionen:
https://www.mgh-bibliothek.de//cgi-bin/da/da692/da692.pl?seite=828.gif&start=828 (DA)
https://recensio.net/r/1825fc51ff4a494b8cf6e9a9ef259746 (MIÖG)
https://www.kbl.badw-muenchen.de/zblg-online/rezension_2038.html (ZBLG)

https://www.landesarchiv-bw.de/web/57834
Rezensionen:
https://www.mgh-bibliothek.de//cgi-bin/da/da692/da692.pl?seite=828.gif&start=828 (DA)
https://recensio.net/r/1825fc51ff4a494b8cf6e9a9ef259746 (MIÖG)
https://www.kbl.badw-muenchen.de/zblg-online/rezension_2038.html (ZBLG)

KlausGraf - am Mittwoch, 15. April 2015, 16:41 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk bleibt es weitgehend selbst überlassen, seine Inhalte systematisch zu archivieren. Besser wäre es, wenn wie bei Büchern stets Pflichtexemplare abgeliefert werden müssen, sagt der Medienwissenschaftler Leif Kramp im iRights.info-Interview. "
https://irights.info/artikel/archive-oeffentlich-rechtlicher-rundfunkbeitrag-pflichtexemplar-kramp/25211
https://irights.info/artikel/archive-oeffentlich-rechtlicher-rundfunkbeitrag-pflichtexemplar-kramp/25211
KlausGraf - am Mittwoch, 15. April 2015, 16:10 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Sehr geehrte Damen und Herren,
unter der Adresse
https://www.stadtarchiv-reutlingen.findbuch.net/
finden Sie neuerdings einen der zentralen Findbehelfe zu den Beständen der reichsstädtischen Geschichte Reutlingens online eingestellt. Die „Reichsstädtischen Urkunden und Akten“ wurde im Wesentlichen nach Rückholung und Ordnung des städtischen Archivs nach dem Zweiten Weltkrieg von Oberstudiendirektor i. R. Dr. Hermann Kalchreuter (1887–1961) neu geordnet und in 26 maschinengeschriebenen Repertorienbänden erschlossen (vgl. seinen Beitrag in den Reutlinger Geschichtsblättern NF 1 (1958/59), S. 47 ff.). Obwohl der Bearbeiter, der außerhalb seiner schulischen Tätigkeit bis 1945 vorwiegend durch philologische Arbeiten hervorgetreten war, weder fachlich ausgebildeter Archivar noch Historiker gewesen ist, hat diese Arbeit durch die ungewöhnlich umfangreiche Regestierung ihren eigenen Wert. Vielfach sind die ab 1298 vorliegenden Urkunden und Akten in Vollregesten, zuweilen gar abschriftlich wiedergegeben.
Bei den Reutlinger Urkunden und Akten handelt es sich keineswegs um einen provenienzgerecht formierten Bestand. Vielfach stehen Pertinenzen wie „Kaufbriefe“ neben provenienzgemäßen Überlieferungen wie etwa der Bechtenpflege, eine auf eine mittelalterliche Stiftung zurückgehende Vermögensmasse. Zudem war es das Bestreben Kalchreuters, durch Einbeziehung von wichtigen, im 19. Jahrhundert im Zuge der Mediatisierung Reutlingens nach Stuttgart überführten Urkunden einen Blick auf zentrale Dokumente – in erster Linie kaiserliche Privilegien – der ursprünglich reichsstädtischen Überlieferung zu geben. Die Verweise zum Original sind in den Titelaufnahmen jeweils angegeben. Dies gilt auch für die später innerhalb des Stadtarchivs extradierten Lagerbücher (jetzt: Bestand A 4 „Reutlinger Urbare“) sowie für Einzelstücke wie bspw. vorreformatorische „Kirchensachen“ (jetzt: Bestände A 1 und A 3).
Die 2014/15 durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ermöglichte digitale Retrokonversion der vorliegenden, bislang nur im Lesesaal des Archivs benutzbaren Repertorien stellt der Forschung nun rund 8000 Dokumente zur Stadt- und Regionalgeschichte online zur Verfügung. Aus arbeitsökonomischen Gründen wurde davon abgesehen, die Regesten entsprechend heutigen Standards nachzubearbeiten. Obschon so nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Fehler in das umfängliche Werk eingeschlichen haben, wurde die Nachbearbeitung auf das unbedingt Notwendige beschränkt. – Der wissenschaftlichen Lauterkeit wird auch im digitalen Zeitalter der Blick auf das Original unentbehrlich bleiben.
Die Einstellung weiterer Findbücher des Stadtarchivs wird in den nächsten Jahren folgen, ebenso wird je nach Haushaltssituation die Einstellung digitalisierter Bestände angestrebt. Mit dem Urkundenselekt (Bestand A 3) wurde ein erster kleinerer Bestand bereits aufgenommen.
Das Team des Stadtarchivs ist dankbar für Rückmeldungen und Kritik. Wir hoffen, der Öffentlichkeit ein nützliches und für die historische Forschung fruchtbares Instrument an die Hand geben zu können. Der Dank geht bereits jetzt an Dr. Claudius Kienzle, vormals Archivschule Marburg (jetzt Landeskirchliches Archiv Stuttgart), für die sehr hilfreiche Beratung.
Mit kollegialen Grüßen
Dr. Roland Deigendesch "
Wieso sollte ein Blick auf das Findmittel-Original erforderlich sein? Dann hätte man doch einfach PDFs der Bände zusätzlich beigeben können. Oder sind die Originale der verzeichneten Unterlagen gemeint?
unter der Adresse
https://www.stadtarchiv-reutlingen.findbuch.net/
finden Sie neuerdings einen der zentralen Findbehelfe zu den Beständen der reichsstädtischen Geschichte Reutlingens online eingestellt. Die „Reichsstädtischen Urkunden und Akten“ wurde im Wesentlichen nach Rückholung und Ordnung des städtischen Archivs nach dem Zweiten Weltkrieg von Oberstudiendirektor i. R. Dr. Hermann Kalchreuter (1887–1961) neu geordnet und in 26 maschinengeschriebenen Repertorienbänden erschlossen (vgl. seinen Beitrag in den Reutlinger Geschichtsblättern NF 1 (1958/59), S. 47 ff.). Obwohl der Bearbeiter, der außerhalb seiner schulischen Tätigkeit bis 1945 vorwiegend durch philologische Arbeiten hervorgetreten war, weder fachlich ausgebildeter Archivar noch Historiker gewesen ist, hat diese Arbeit durch die ungewöhnlich umfangreiche Regestierung ihren eigenen Wert. Vielfach sind die ab 1298 vorliegenden Urkunden und Akten in Vollregesten, zuweilen gar abschriftlich wiedergegeben.
Bei den Reutlinger Urkunden und Akten handelt es sich keineswegs um einen provenienzgerecht formierten Bestand. Vielfach stehen Pertinenzen wie „Kaufbriefe“ neben provenienzgemäßen Überlieferungen wie etwa der Bechtenpflege, eine auf eine mittelalterliche Stiftung zurückgehende Vermögensmasse. Zudem war es das Bestreben Kalchreuters, durch Einbeziehung von wichtigen, im 19. Jahrhundert im Zuge der Mediatisierung Reutlingens nach Stuttgart überführten Urkunden einen Blick auf zentrale Dokumente – in erster Linie kaiserliche Privilegien – der ursprünglich reichsstädtischen Überlieferung zu geben. Die Verweise zum Original sind in den Titelaufnahmen jeweils angegeben. Dies gilt auch für die später innerhalb des Stadtarchivs extradierten Lagerbücher (jetzt: Bestand A 4 „Reutlinger Urbare“) sowie für Einzelstücke wie bspw. vorreformatorische „Kirchensachen“ (jetzt: Bestände A 1 und A 3).
Die 2014/15 durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ermöglichte digitale Retrokonversion der vorliegenden, bislang nur im Lesesaal des Archivs benutzbaren Repertorien stellt der Forschung nun rund 8000 Dokumente zur Stadt- und Regionalgeschichte online zur Verfügung. Aus arbeitsökonomischen Gründen wurde davon abgesehen, die Regesten entsprechend heutigen Standards nachzubearbeiten. Obschon so nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Fehler in das umfängliche Werk eingeschlichen haben, wurde die Nachbearbeitung auf das unbedingt Notwendige beschränkt. – Der wissenschaftlichen Lauterkeit wird auch im digitalen Zeitalter der Blick auf das Original unentbehrlich bleiben.
Die Einstellung weiterer Findbücher des Stadtarchivs wird in den nächsten Jahren folgen, ebenso wird je nach Haushaltssituation die Einstellung digitalisierter Bestände angestrebt. Mit dem Urkundenselekt (Bestand A 3) wurde ein erster kleinerer Bestand bereits aufgenommen.
Das Team des Stadtarchivs ist dankbar für Rückmeldungen und Kritik. Wir hoffen, der Öffentlichkeit ein nützliches und für die historische Forschung fruchtbares Instrument an die Hand geben zu können. Der Dank geht bereits jetzt an Dr. Claudius Kienzle, vormals Archivschule Marburg (jetzt Landeskirchliches Archiv Stuttgart), für die sehr hilfreiche Beratung.
Mit kollegialen Grüßen
Dr. Roland Deigendesch "
Wieso sollte ein Blick auf das Findmittel-Original erforderlich sein? Dann hätte man doch einfach PDFs der Bände zusätzlich beigeben können. Oder sind die Originale der verzeichneten Unterlagen gemeint?
KlausGraf - am Mittwoch, 15. April 2015, 16:07 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Helge Kleifeld - am Mittwoch, 15. April 2015, 15:28 - Rubrik: Bestandserhaltung
Nachricht des Administrators 11.5.2015: Aus Platzgründen musste die Datei gelöscht werden. Der Inhalt:
Effektivität von Massenentsäuerungsverfahren? Fachdiskussion notwendig und erwünscht!
Anläßlich der Tagung des Arbeitskreises Nordrhein-Westfälischer Papierrestauratoren e.V. am 23. und
24. März 2015 wurde u. a. über die Entwicklung einer international gültigen „Technical Spezification“
im Rahmen der ISO zur Überprüfung der Effektivität von Entsäuerungsverfahren berichtet. Bisher
existieren die 2007 erstmals publizierten sogenannten DIN-Empfehlungen nach Hofmann und
Wiesner1
. Schon diese Empfehlungen wurden bei den Auftraggebern von Entsäuerungsaufträgen nicht
recht umgesetzt. So wurden von zahlreichen Auftraggebern in ihren Ausschreibungen allerlei
Abwandlungen und Zusatzkriterien aufgeführt, um besser zu gewährleisten, daß ein Erfolg der
Entsäuerung auch in Originalpapieren gegeben sei.
Eine Fachdiskussion über die DIN-Empfehlungen von Entsäuerungsaufträgen hat in Deutschland
leider nie stattgefunden, obwohl dies aufgrund der ungenügenden Akzeptanz der DIN-Empfehlungen
auf Seiten der Auftraggeber wohl geboten gewesen wäre.
Der Bericht über die „Technical Spezification“ machte deutlich, daß mit dem Schritt in die
Internationalisierung zumindest nach dem gegenwärtigen Stand der Bearbeitung weniger eine
sachgerechte Verbesserung im Sinne der Auftraggeber stattgefunden hat, sondern eher eine
„Verschlankung“ der Prüfmittel und -kriterien. Besonders wichtig war der im Rahmen der Tagung
seitens der Leitung des verantwortlichen ISO-Expertengremiums gegebene Hinweis, daß die Arbeit an
der „Technical Spezification“ nach den drei Jahren Diskussion im Rahmen der ISO nun erst begänne
und noch weitreichende Veränderungen durch die Diskussion in den nationalen
Normungsorganisationen vorgenommen werden könnten – bis hin zur Ablehnung der „Technical
Spezification“ durch das verantwortliche DIN-Gremium.
Durch die öffentlichen Wortmeldungen während der Tagung, aber vor allem durch zahlreiche
„Flurgespräche“ mit den Tagungsteilnehmern zeigte sich großes Interesse an der Normungsarbeit und
vor allem an ihren Ergebnissen, da diese große Auswirkungen auf die tägliche Arbeit der mit der
Entsäuerung beschäftigten Restauratorinnen und Restauratoren ausüben werden. Vor diesem
Hintergrund stellt sich die Frage, warum diese Problematik nicht längst durch eine Diskussion in der
Fachöffentlichkeit begleitet worden ist? Die Arbeit im Rahmen der ISO ist immerhin schon soweit
fortgeschritten, daß ein abgeschlossener Textvorschlag an die nationalen Normungsorganisationen zur
Begutachtung übermittelt wurde. Ein Vorschlag, der vermutlich nicht mit dem Ziel entwickelt worden
ist, noch einmal komplett überarbeitet zu werden oder größere Veränderungen aufzunehmen.
So sollte die Fachöffentlichkeit das oben widergegebene Wort aus dem Teilnehmerkreis der Tagung,
daß die Arbeit nun erst begänne, für bare Münze nehmen! Warum sollte ein solcher Arbeitsprozess
nicht begleitet werden durch eine breite Diskussion in der Fachöffentlichkeit? Eine breite Diskussion
aus dem Kreise der betroffenen Restauratoren, Archivare und Bibliothekare. Ohnehin hätte eine solche
Diskussion bereits nach der ersten Publikation der DIN-Empfehlungen 2007/2008 stattfinden müssen.
Bei dem jetzigen Bearbeitungsstand ist es fast schon zu spät. Doch besser spät als nie, wie der
Volksmund sagt. Es sollte sich ein berufenes Gremium finden, dass eine solche Diskussion anstößt
und organisatorisch begleitet. Hierbei sind besonders die Restauratoren, Archivare und Bibliothekare
gefragt und die in diesen Kreisen existierenden berufenen Arbeitsorganisationen.
Dr. Helge Kleifeld
1 Hofmann, Rainer / Wiesner, Hans-Jörg, Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken, 4., überarbeitete und
erweiterte Auflage (Erstauflage 2007), Hrsg. DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin / Wien / Zürich
2013; hierin: Empfehlungen zur Prüfung des Behandlungserfolges von Entsäuerungsverfahren für säurehaltige
Druck- und Schreibpapiere, S 13-37.
Helge Kleifeld - am Mittwoch, 15. April 2015, 15:22 - Rubrik: Bestandserhaltung
Der Arbeitskreis „Sport und Geschichte“ beim Landessportbund Hessen hat im Herbst des letzten Jahres eine Umfrage zur Archivarbeit und Sportüberlieferung in hessischen Sportvereinen gestartet. Alle Sportkreise wurden deshalb gebeten, einen zweiseitigen Fragebogen an die Vereine in ihrem Zuständigkeitsbereich weiterzuleiten. Die ausgefüllten Bogen sollten bis spätestens 15. Dezember 2014 an den Landessportbund Hessen (lsb h) zurück geschickt werden.
Die Auswertung der beim lsb h - Arbeitskreis „Sport und Geschichte“ eingetroffenen Erhebungsunterlagen führte zu dem Ergebnis, dass sich 334 Vereine an der Umfrage beteiligt haben. Das entspricht bei insgesamt 7.800 hessischen Vereinen einer Rücklaufquote von etwas mehr als 4%. Aus 8 hessischen Sportkreisen ist allerdings von keinem einzigen Verein ein ausgefüllter Fragebogen zurückgegeben worden!
Aus den ausgefüllten Fragebogen ergibt sich unter Berücksichtigung von Mehrfachnennungen erwartungsgemäß, dass mehr als 80% der Sportvereine ihre Unterlagen nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen in der Wohnung eines Vorstandsmitglieds oder in den eigenen Vereinsräumen aufbewahren. Nur in etwas mehr als 10% der Fälle sind diese Unterlagen aber auch für interessierte Außenstehende unter Beachtung der Schutzfristen zugänglich.
Dies bedeutet unter anderem, dass alle anderen Unterlagen in der Regel nicht für sportgeschichtliche Auswertungen zu nutzen sind. Außerdem ist es zweifelhaft, ob diese Unterlagen überhaupt archivgerecht aufbewahrt und damit auf Dauer erhalten werden. Deshalb vertritt der lsb h - Arbeitskreis „Sport und Geschichte“ schon seit vielen Jahren die Auffassung, dass Sportvereine grundsätzlich mit den jeweils zuständigen Kommunalarchiven zusammen arbeiten sollten, wenn es um die Archivierung der Vereinsunterlagen geht.
Dieser Empfehlung folgen bisher allerdings nur insgesamt 13 und damit noch nicht einmal 3% der 334 antwortenden Sportvereine! Damit wird deutlich, dass der ganz überwiegende Teil aller Vereine offensichtlich der Meinung ist, dass auf die sachgerechte Aufbewahrung der erhaltenswerten Unterlagen nicht geachtet werden muß. Offenbar sind die Vereine auch nur wenig an sporthistorischer Forschungsarbeit auf lokaler und regionaler Ebene interessiert.
Diese Haltung spiegelt sich zumindest in den Antworten der 60 Vereine, die mitgeteilt haben, dass bei ihnen erhaltenswerte Akten und Unterlagen bedenkenlos ganz einfach vernichtet werden! Angesichts einer derart ernüchternden Ausgangslage stimmt es zumindest hoffnungsvoll, dass fast die Hälfte der antwortenden Sportvereine Interesse an einer Beratung zu Fragen der Archivierung von Akten und Unterlagen angemeldet hat.
Ein Viertel dieser Nennungen bezieht sich auf Grundfragen der Archivarbeit. Weitere zentrale Themen sind die Archivierung von Fotos und die Aufbewahrung von Objekten wie Medaillen, Pokalen und Urkunden. Danach folgen die Themen „Beschaffung von Materialien für die Archivarbeit“ sowie „Erstellung von Festschriften“.
In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass mit Ulrich Manthei als Vorsitzendem des Beirats der Sportkreise bereits vor einiger Zeit vereinbart wurde, die Fortbildung der ehrenamtlichen Vereinsarchivare künftig dezentral zu organisieren. Dies gilt erst recht für die Beratung der Vereine, die eine ortsnahe Koordinierung erfordert. Daher sei noch auf die regionalen Schwerpunkte der Beratungswünsche hingewiesen, die sich aus der Umfrage ergeben.
An der Spitze liegt hier der Sportkreis Frankfurt mit insgesamt 42 Nennungen. Danach folgen die Sportkreise Bergstraße und Waldeck-Frankenberg mit jeweils 39 Nennungen. Aber auch die Sportkreise Hochtaunus, Groß-Gerau, Vogelsberg und Schwalm-Eder haben großes Interesse an der Beratung zu verschiedenen Themen geäußert. Natürlich ist der lbs h - Arbeitskreis „Sport und Geschichte“ gerne bereit, die weiteren Planungen der Sportkreise tatkräftig zu unterstützen.
Peter Schermer
Die Auswertung der beim lsb h - Arbeitskreis „Sport und Geschichte“ eingetroffenen Erhebungsunterlagen führte zu dem Ergebnis, dass sich 334 Vereine an der Umfrage beteiligt haben. Das entspricht bei insgesamt 7.800 hessischen Vereinen einer Rücklaufquote von etwas mehr als 4%. Aus 8 hessischen Sportkreisen ist allerdings von keinem einzigen Verein ein ausgefüllter Fragebogen zurückgegeben worden!
Aus den ausgefüllten Fragebogen ergibt sich unter Berücksichtigung von Mehrfachnennungen erwartungsgemäß, dass mehr als 80% der Sportvereine ihre Unterlagen nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen in der Wohnung eines Vorstandsmitglieds oder in den eigenen Vereinsräumen aufbewahren. Nur in etwas mehr als 10% der Fälle sind diese Unterlagen aber auch für interessierte Außenstehende unter Beachtung der Schutzfristen zugänglich.
Dies bedeutet unter anderem, dass alle anderen Unterlagen in der Regel nicht für sportgeschichtliche Auswertungen zu nutzen sind. Außerdem ist es zweifelhaft, ob diese Unterlagen überhaupt archivgerecht aufbewahrt und damit auf Dauer erhalten werden. Deshalb vertritt der lsb h - Arbeitskreis „Sport und Geschichte“ schon seit vielen Jahren die Auffassung, dass Sportvereine grundsätzlich mit den jeweils zuständigen Kommunalarchiven zusammen arbeiten sollten, wenn es um die Archivierung der Vereinsunterlagen geht.
Dieser Empfehlung folgen bisher allerdings nur insgesamt 13 und damit noch nicht einmal 3% der 334 antwortenden Sportvereine! Damit wird deutlich, dass der ganz überwiegende Teil aller Vereine offensichtlich der Meinung ist, dass auf die sachgerechte Aufbewahrung der erhaltenswerten Unterlagen nicht geachtet werden muß. Offenbar sind die Vereine auch nur wenig an sporthistorischer Forschungsarbeit auf lokaler und regionaler Ebene interessiert.
Diese Haltung spiegelt sich zumindest in den Antworten der 60 Vereine, die mitgeteilt haben, dass bei ihnen erhaltenswerte Akten und Unterlagen bedenkenlos ganz einfach vernichtet werden! Angesichts einer derart ernüchternden Ausgangslage stimmt es zumindest hoffnungsvoll, dass fast die Hälfte der antwortenden Sportvereine Interesse an einer Beratung zu Fragen der Archivierung von Akten und Unterlagen angemeldet hat.
Ein Viertel dieser Nennungen bezieht sich auf Grundfragen der Archivarbeit. Weitere zentrale Themen sind die Archivierung von Fotos und die Aufbewahrung von Objekten wie Medaillen, Pokalen und Urkunden. Danach folgen die Themen „Beschaffung von Materialien für die Archivarbeit“ sowie „Erstellung von Festschriften“.
In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass mit Ulrich Manthei als Vorsitzendem des Beirats der Sportkreise bereits vor einiger Zeit vereinbart wurde, die Fortbildung der ehrenamtlichen Vereinsarchivare künftig dezentral zu organisieren. Dies gilt erst recht für die Beratung der Vereine, die eine ortsnahe Koordinierung erfordert. Daher sei noch auf die regionalen Schwerpunkte der Beratungswünsche hingewiesen, die sich aus der Umfrage ergeben.
An der Spitze liegt hier der Sportkreis Frankfurt mit insgesamt 42 Nennungen. Danach folgen die Sportkreise Bergstraße und Waldeck-Frankenberg mit jeweils 39 Nennungen. Aber auch die Sportkreise Hochtaunus, Groß-Gerau, Vogelsberg und Schwalm-Eder haben großes Interesse an der Beratung zu verschiedenen Themen geäußert. Natürlich ist der lbs h - Arbeitskreis „Sport und Geschichte“ gerne bereit, die weiteren Planungen der Sportkreise tatkräftig zu unterstützen.
Peter Schermer
Peter Schermer - am Mittwoch, 15. April 2015, 11:27 - Rubrik: Sportarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dann doch lieber survival und noch lange nach dem Tod Bücher schreiben über aktuelle Themen. (Das HBZ sollte sich was schemen.)
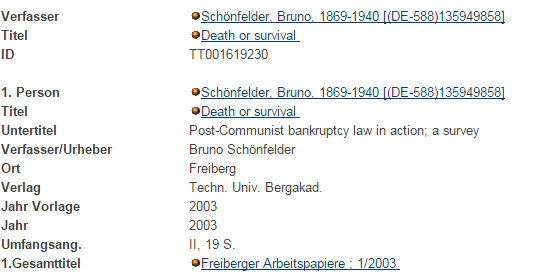
https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=135949858
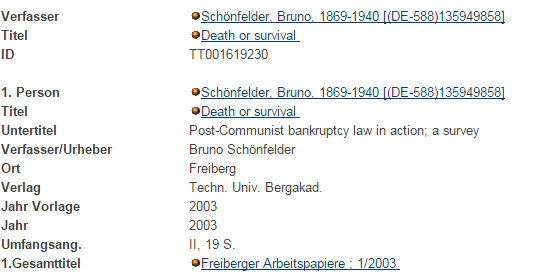
https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=135949858
KlausGraf - am Dienstag, 14. April 2015, 22:26 - Rubrik: Unterhaltung
Eine Petition, die ich unterstützt habe:
https://www.openpetition.de/petition/online/fur-deutschsprachige-antrage-beim-fwf
https://www.openpetition.de/petition/online/fur-deutschsprachige-antrage-beim-fwf
KlausGraf - am Dienstag, 14. April 2015, 19:19 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.worms.de/de/kultur/stadtarchiv/Aktuelles.php
In brauchbarer Auflösung, ohne Wasserzeichen, aber im Augias-Viewer (kein Download).

In brauchbarer Auflösung, ohne Wasserzeichen, aber im Augias-Viewer (kein Download).

KlausGraf - am Dienstag, 14. April 2015, 16:33 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 14. April 2015, 15:20 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.welt.de/kultur/article139489335/Deutsch-gehoert-zu-den-Top-fuenf-der-Weltsprachen.html
"Besser lief die Kommunikation mit den Amischen in Pennsylvania, Angehörigen einer Sekte, die im 18. Jahrhundert ausgewandert ist und bis heute einen altertümlichen pfälzischen Dialekt spricht. Die sind zwar auch in der Lage, sich hochdeutsch auszudrücken. Aber als der in Backnang geborene Ammon, ein "Muttersprachler des Schwäbischen", sie in seinem Heimatidiom anschwätzte, wurden sie flüssiger: "Des ischa genau gleich wia bei uns.""
"Besser lief die Kommunikation mit den Amischen in Pennsylvania, Angehörigen einer Sekte, die im 18. Jahrhundert ausgewandert ist und bis heute einen altertümlichen pfälzischen Dialekt spricht. Die sind zwar auch in der Lage, sich hochdeutsch auszudrücken. Aber als der in Backnang geborene Ammon, ein "Muttersprachler des Schwäbischen", sie in seinem Heimatidiom anschwätzte, wurden sie flüssiger: "Des ischa genau gleich wia bei uns.""
KlausGraf - am Dienstag, 14. April 2015, 13:18 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Im Katalog der Innsbrucker Maximilian-Ausstellung 1969 versteckt sich ein Hinweis auf die unter
https://manuscripta.at/?ID=24807
verzeichnete Handschrift, den ich aber zunächst trotz mehrfacher, offenkundig zu flüchtiger Durchsicht überlesen hatte (die Maximilian-Ausstellung 1959 hatte ein Handschriftenregister!). WIE bekomme ich mittels des Internets trotzdem heraus, auf welcher Seite das Gedicht behandelt wird?
Siehe auch
https://archiv.twoday.net/stories/1022414007/

https://manuscripta.at/?ID=24807
verzeichnete Handschrift, den ich aber zunächst trotz mehrfacher, offenkundig zu flüchtiger Durchsicht überlesen hatte (die Maximilian-Ausstellung 1959 hatte ein Handschriftenregister!). WIE bekomme ich mittels des Internets trotzdem heraus, auf welcher Seite das Gedicht behandelt wird?
Siehe auch
https://archiv.twoday.net/stories/1022414007/

KlausGraf - am Dienstag, 14. April 2015, 04:24 - Rubrik: Unterhaltung
https://www.authorsalliance.org/2015/04/09/keeping-your-books-available/
"Today, Authors Alliance releases Understanding Rights Reversion: When, Why, & How to Regain Copyright and Make Your Book More Available, a guide that arms authors with the information and strategies they need to revive their books. This guide is the product of extensive outreach to the publishing industry. In the process, we interviewed authors, publishers, and literary agents, ranging from a CEO of a major publishing house to contracts and rights managers of trade and academic presses, editorial assistants, novelists, and academic authors."
Zur deutschen Rechtslage:
https://archiv.twoday.net/stories/197330649/ (bei Endnote 14)
https://archiv.twoday.net/stories/41794350/
"Today, Authors Alliance releases Understanding Rights Reversion: When, Why, & How to Regain Copyright and Make Your Book More Available, a guide that arms authors with the information and strategies they need to revive their books. This guide is the product of extensive outreach to the publishing industry. In the process, we interviewed authors, publishers, and literary agents, ranging from a CEO of a major publishing house to contracts and rights managers of trade and academic presses, editorial assistants, novelists, and academic authors."
Zur deutschen Rechtslage:
https://archiv.twoday.net/stories/197330649/ (bei Endnote 14)
https://archiv.twoday.net/stories/41794350/
KlausGraf - am Dienstag, 14. April 2015, 04:01 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Immer wieder erhalten wir Anfragen von Mitgliedern, die auf der erfolglosen Suche nach Ergotherapie-spezifischen Fachpublikationen sind. Bisher findet kaum ein Austausch der wissenschaftlichen Arbeiten statt, und da Abschlussarbeiten zumeist lediglich als Teil der Prüfungsunterlagen und nicht als wissenschaftliche Veröffentlichungen gelten, werden die allerwenigsten Abschlussarbeiten publiziert und, noch dramatischer, nach Ablauf der gesetzlichen Verwahrungsfrist von der Universität oder Hochschule vernichtet. Interessante und wichtige Ergebnisse der Abschlussarbeiten verstauben somit im eigenen Regal oder vergilben nutzlos in der Schublade, anstatt anderen Absolventen und Forschern zugänglich gemacht zu werden.Diesen Zustand möchte der DVE nun ändern und hat aus diesem Grund auf seiner neuen Homepage unter www.dve.info - Service - Diplom/Bsc/Msc-Arbeiten eine Datenbank für Ihre Abschlussarbeit eingerichtet.
https://www.dve.info/nc/service/aktuelles/artikel/article/datenbank-fuer-abschlussarbeiten-4.html
https://www.dve.info/nc/service/aktuelles/artikel/article/datenbank-fuer-abschlussarbeiten-4.html
KlausGraf - am Dienstag, 14. April 2015, 03:36 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://informationspraxis.de/2015/04/09/open-peer-review-linhart-sichtbarkeit-von-open-access-hochschulschriften-eine-untersuchung-deutscher-institutioneller-repositorien
Mein Kommentar:
Ich hoffe dass ich die Zeit finde, ausführlicher dazulegen, wieso ich diese Arbeit nicht für publikationsfähig halte. Sie weist schwere methodische Mängel auf.
Es ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel, sich mit einem ausgesprochenen Stiefkind der sogenannten Hochschulschriften, siehe dazu Steinhauer 2005
https://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg28333.html
zu befassen, ohne deren Besonderheiten auch nur ansatzweise zu reflektieren. dass es um Abschlussarbeiten [Prüfungsarbeiten] geht, wird weder im Titel noch im Abstract gesagt.
Fachliteratur bzw. öffentliche Stellungnahmen von mir liegen dazu in reicher Fülle vor, von anderen ist eher wenig dazu geschrieben worden. Siehe nur
https://archiv.twoday.net/stories/1022386381/
Es fehlen die angekündigten Anhänge. Research data sollten immer verpflichtend beigegeben werden.
Mein Kommentar:
Ich hoffe dass ich die Zeit finde, ausführlicher dazulegen, wieso ich diese Arbeit nicht für publikationsfähig halte. Sie weist schwere methodische Mängel auf.
Es ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel, sich mit einem ausgesprochenen Stiefkind der sogenannten Hochschulschriften, siehe dazu Steinhauer 2005
https://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg28333.html
zu befassen, ohne deren Besonderheiten auch nur ansatzweise zu reflektieren. dass es um Abschlussarbeiten [Prüfungsarbeiten] geht, wird weder im Titel noch im Abstract gesagt.
Fachliteratur bzw. öffentliche Stellungnahmen von mir liegen dazu in reicher Fülle vor, von anderen ist eher wenig dazu geschrieben worden. Siehe nur
https://archiv.twoday.net/stories/1022386381/
Es fehlen die angekündigten Anhänge. Research data sollten immer verpflichtend beigegeben werden.
KlausGraf - am Montag, 13. April 2015, 23:47 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Im März im ehemaligen erzbischöflichen Palast von Rouen. In der Stadt in der Normandie wurde die Freiheitskämpferin 1431 zum Tode verurteilt.
https://www.historial-jeannedarc.fr/
https://artdaily.com/news/76675/Rouen-to-open-new-museum-dedicated-to-tracing-the-history-of-French-heroine-Joan-of-Arc-#.VSwda_msXHt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historial_Jeanne_d%27Arc
https://museumswelt.blog.de/2015/03/21/rouen-historial-jeanne-d-arc-eroeffnet-20197037/
https://www.historial-jeannedarc.fr/
https://artdaily.com/news/76675/Rouen-to-open-new-museum-dedicated-to-tracing-the-history-of-French-heroine-Joan-of-Arc-#.VSwda_msXHt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historial_Jeanne_d%27Arc
https://museumswelt.blog.de/2015/03/21/rouen-historial-jeanne-d-arc-eroeffnet-20197037/
KlausGraf - am Montag, 13. April 2015, 21:50 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Umgang mit den Dissertationen, deren Verfasser ihren Doktorgrad verloren haben, ist höchst unheitlich und teils skandalös. Das zeigt eine neue Website:
https://depromo.wordpress.com/
https://depromo.wordpress.com/
KlausGraf - am Montag, 13. April 2015, 21:37 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
https://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/omniscriptum-verlag-veroeffentlicht-abschlussarbeiten-a-1027491.html
"Sicherlich mehr als 100000" potenzielle Autoren schreibe OmniScriptum jährlich an, sagt Wolfgang P. Müller, Gründer und Alleingesellschafter der Unternehmensgruppe. Nicht alle machen mit, aber die Quote ist so hoch, dass es kein Verlag der Welt auf mehr Neuerscheinungen bringt: Zwischen 30000 und 35000 Buchtitel veröffentlicht OmniScriptum pro Jahr, davon etwa 80 Prozent in der akademischen Sparte.
Diese Bücher, die hinterher über Buchhändler als Fachliteratur zu Preisen zwischen 10 und 250 Euro verkauft werden, sind: schnöde Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten. Ganz gleich, aus welchem Fachgebiet sie stammen, mit welcher Note sie bewertet wurden, ob sie vor Rechtschreibfehlern oder gar inhaltlichen Mängeln strotzen – der Verlag hat Interesse daran und lektoriert sowie korrigiert nichts. Egal, ob fette Fehler drin stehen – Hauptsache, das Buch ist erst mal im Programm.
Dieses Geschäftsmodell, das unweigerlich Tausende enttäuschte Leser produzieren muss, nennt Müller "überaus erfolgreich": 1,6 Millionen Bücher seien so im vergangenen Jahr verkauft worden. Das lohnt sich für OmniScriptum, dessen Gewinne im Millionenbereich liegen.
Zum Thema hier:
https://archiv.twoday.net/stories/1022417508/#1022417992
https://archiv.twoday.net/stories/472713645/
Typisch ist die Arroganz, mit der alle Arbeiten in dieser Verlagsgruppe über einen Kamm geschoren werden. Entscheidend ist die Qualität der einzelnen Arbeit, nicht das Umfeld. Und Fehler gibt es selbst in den exzellentesten Arbeiten. Stichwort "Qualitäts-Fetisch".
"Sicherlich mehr als 100000" potenzielle Autoren schreibe OmniScriptum jährlich an, sagt Wolfgang P. Müller, Gründer und Alleingesellschafter der Unternehmensgruppe. Nicht alle machen mit, aber die Quote ist so hoch, dass es kein Verlag der Welt auf mehr Neuerscheinungen bringt: Zwischen 30000 und 35000 Buchtitel veröffentlicht OmniScriptum pro Jahr, davon etwa 80 Prozent in der akademischen Sparte.
Diese Bücher, die hinterher über Buchhändler als Fachliteratur zu Preisen zwischen 10 und 250 Euro verkauft werden, sind: schnöde Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten. Ganz gleich, aus welchem Fachgebiet sie stammen, mit welcher Note sie bewertet wurden, ob sie vor Rechtschreibfehlern oder gar inhaltlichen Mängeln strotzen – der Verlag hat Interesse daran und lektoriert sowie korrigiert nichts. Egal, ob fette Fehler drin stehen – Hauptsache, das Buch ist erst mal im Programm.
Dieses Geschäftsmodell, das unweigerlich Tausende enttäuschte Leser produzieren muss, nennt Müller "überaus erfolgreich": 1,6 Millionen Bücher seien so im vergangenen Jahr verkauft worden. Das lohnt sich für OmniScriptum, dessen Gewinne im Millionenbereich liegen.
Zum Thema hier:
https://archiv.twoday.net/stories/1022417508/#1022417992
https://archiv.twoday.net/stories/472713645/
Typisch ist die Arroganz, mit der alle Arbeiten in dieser Verlagsgruppe über einen Kamm geschoren werden. Entscheidend ist die Qualität der einzelnen Arbeit, nicht das Umfeld. Und Fehler gibt es selbst in den exzellentesten Arbeiten. Stichwort "Qualitäts-Fetisch".
KlausGraf - am Montag, 13. April 2015, 21:26 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 13. April 2015, 21:21 - Rubrik: Archivrecht
Das Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW), der Verein für Computergenealogie e. V. (CompGen) und das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Kooperation mit dem GEWISS Konsortium „BürGEr schaffen WISSen - Wissen schafft Bürger“ laden zu einem zweitägigen Dialogforum ein:
„Datenqualität, Datenmanagement und rechtliche Aspekte in Citizen Science“
Datum: 04./05. Mai 2015
Ort: ZBW- Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Neuer Jungfernstieg 21, Hamburg 20354
Nähere Informationen unter https://www.zbw.eu/de/ueber-uns/veranstaltungen/citizen-science/
„Datenqualität, Datenmanagement und rechtliche Aspekte in Citizen Science“
Datum: 04./05. Mai 2015
Ort: ZBW- Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Neuer Jungfernstieg 21, Hamburg 20354
Nähere Informationen unter https://www.zbw.eu/de/ueber-uns/veranstaltungen/citizen-science/
TKluttig - am Montag, 13. April 2015, 21:21 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 13. April 2015, 21:18 - Rubrik: Fotoueberlieferung
KlausGraf - am Montag, 13. April 2015, 01:38 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 13. April 2015, 01:31 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Vizepräsident für Lehre an der Technischen Universität Hamburg-Harburg Sönke Knutzen über die Pläne, ein eigenes Online-Angebot der Hamburger Hochschulen aufzubauen – „Freies Wissen gegen Googles Algorithmen“.
https://albatros.antville.org/stories/2220994/
https://albatros.antville.org/stories/2220994/
KlausGraf - am Sonntag, 12. April 2015, 22:02 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dagegen argumentiert zu Recht aus der Sicht von Open Access:
https://occamstypewriter.org/scurry/2015/04/08/open-access-a-national-licence-is-not-the-answer/
Eine Satire:
https://followersoftheapocalyp.se/a-local-license-for-henbury-a-response-to-hepi_news/
https://occamstypewriter.org/scurry/2015/04/08/open-access-a-national-licence-is-not-the-answer/
Eine Satire:
https://followersoftheapocalyp.se/a-local-license-for-henbury-a-response-to-hepi_news/
KlausGraf - am Sonntag, 12. April 2015, 17:55 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://eprints.soton.ac.uk/375854/
Die neue Studie, auf die mich Richard Poynder hinwies, zeigt, dass trotz aller OA-Policies, wie sie Harnadianer (Harnad ist Mitautor) unermüdlich propagieren, die Ausbeute der Institutionellen Repositorien erbärmlich gering ist. Untersucht wurden Zeitschriftenartikel 2011-2013 im Web of Knowledge.
77 % wurde nicht in ein IR aufgenommen.
8 % (der Gesamtzahl) sind nur als Metadaten präsent.
3 % sind Dark deposits (restricted access). Zu ihnen siehe
https://archiv.twoday.net/stories/1022220766/
Das bedeutet hinsichtlich der IR-Inhalte (Aufteilung der 23 %): Von 100 Artikeln, die dort vorhanden sind, sind etwa 52 als OA-Volltext einsehbar, 35 sind nur als Metadaten, und 13 % sind dark deposits.
Das bedeutet übrigens auch: 50 % Nicht-Volltexte müllen die Suchen zu z.B. in BASE.
Von den 4240 Artikeln im WoK der Uni Lüttich sind nur 37 % Open Access, 50 % sind Restricted Acccess.
Institutionen ohne Mandat unterscheiden sich deutlich von solchen mit Mandat. In ersteren liegt der Prozentsatz der nicht eingestellten Artikel bei 90 %, OA sind nur 3 %.
Die Notwendigkeit von Mandaten wurden von Harnad et al. damit begründet, dass man so die etwa mit 25 % angesetzte spontane Deposit-Rate signifikant erhöhen könne. Aber wenn selbst mit lang eingeführten Mandaten nur etwa 25 % der Artikel in IRs landen, stimmt etwas an dieser früheren Argumentation nicht.

Die neue Studie, auf die mich Richard Poynder hinwies, zeigt, dass trotz aller OA-Policies, wie sie Harnadianer (Harnad ist Mitautor) unermüdlich propagieren, die Ausbeute der Institutionellen Repositorien erbärmlich gering ist. Untersucht wurden Zeitschriftenartikel 2011-2013 im Web of Knowledge.
77 % wurde nicht in ein IR aufgenommen.
8 % (der Gesamtzahl) sind nur als Metadaten präsent.
3 % sind Dark deposits (restricted access). Zu ihnen siehe
https://archiv.twoday.net/stories/1022220766/
Das bedeutet hinsichtlich der IR-Inhalte (Aufteilung der 23 %): Von 100 Artikeln, die dort vorhanden sind, sind etwa 52 als OA-Volltext einsehbar, 35 sind nur als Metadaten, und 13 % sind dark deposits.
Das bedeutet übrigens auch: 50 % Nicht-Volltexte müllen die Suchen zu z.B. in BASE.
Von den 4240 Artikeln im WoK der Uni Lüttich sind nur 37 % Open Access, 50 % sind Restricted Acccess.
Institutionen ohne Mandat unterscheiden sich deutlich von solchen mit Mandat. In ersteren liegt der Prozentsatz der nicht eingestellten Artikel bei 90 %, OA sind nur 3 %.
Die Notwendigkeit von Mandaten wurden von Harnad et al. damit begründet, dass man so die etwa mit 25 % angesetzte spontane Deposit-Rate signifikant erhöhen könne. Aber wenn selbst mit lang eingeführten Mandaten nur etwa 25 % der Artikel in IRs landen, stimmt etwas an dieser früheren Argumentation nicht.

KlausGraf - am Sonntag, 12. April 2015, 16:51 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
1861 bot Franz Josef Mone einige Belege aus dem 13. Jahrhundert und frühen 14. Jahrhundert zu Ärzten in Esslingen:
https://books.google.de/books?id=-6wOAAAAYAAJ&hl=de&pg=PA17
Mit dem dort genannten Magister Trutwin (bezeugt in Esslingen als Arzt 1279 bis 1314) habe ich mich in einem Verfasserlexikon-Artikel 1995 näher befasst. Man findet den Artikel mit der Suche nach Trutwin in:
https://www.amazon.de/deutsche-Literatur-Mittelalters-Verfasserlexikon-Reinbold/dp/3110140241/ (für registrierte Benutzer)
Trutwin darf als Verfasser eines lateinischen Gedichts über den Sieg im Reichskrieg gegen Graf Eberhard 1311/12 gelten. Man hat auch die einzigartige Darstellung der Philosophen Plato und Aristoteles im Credofenster der Esslinger Pfarrkirche auf Trutwin zurückführen wollen. Abbildungen:
https://home.bawue.de/~wmwerner/essling/glas04.html
Es gelang mir 1995, den lange vergessenen Zusammenhang zwischen den Esslinger Belegen und den Handschriften eines Magister Trutwin in Stams und Innsbruck wiederherzustellen. Ich konnte seine annalistischen Notizen mit der Fortsetzung der Flores temporum zusammenbringen. Später machte mich Felix Heinzer auf eine Donaueschinger (nun Stuttgarter) Handschrift Trutwins aufmerksam:
https://www.handschriftencensus.de/10574
https://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2000/0215.html
Die Art und Weise, wie Nigel Palmer meine genuine Forschungsleistung 2005 nicht anerkannt hat [auf Wunsch von Herrn Palmer entfernt].
https://books.google.de/books?id=-V4jhcJqY-UC&pg=PA263
Die annalistischen Notizen Trutwins überliefert Innsbruck Cod. 141, Bl. 1v. Der Handschriftenbeschreiber Walter Neuhauser berief sich dort auf meine Mitteilungen aus Niederfell 1988 (damals war ich ans Bundesarchiv Koblenz abgeordnet als Referendar):
https://manuscripta.at/_scripts/php/cat2pdf.php?cat=INN2&ID=7722
Bislang nicht beachtet wurde, dass die Notiz über die Esslinger Wundergeburt 1281 (die den Arzt Trutwin besonders interessieren musste) noch im 13. Jahrhundert mit dem Vermerk "Magister Trutwinus personaliter vidit" in die von Georg Leidinger 1910 edierten Kaisheimer Annalen einging.
https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00084193/image_33
Zur Quelle:
https://www.geschichtsquellen.de/repOpus_00221.html
Schon Leidinger bemerkte, dass damit nicht der aus Esslingen stammende Kaisheimer Abt Trutwin gemeint war, sondern der Esslinger Arzt des Namens, offenbar ein Verwandter des Kaisheimer Abts.
Die Stelle zur Geburt des Monstrums in der Pliensau 1281 in Meuschens Ausgabe der Flores temporum:
https://books.google.de/books?id=ucAWAAAAQAAJ&pg=PA130
(Zu den online verfügbaren Handschriften des Werks, relevant ist hier die Textstufe 3:
https://archiv.twoday.net/stories/248918667/
Der Bericht erscheint auch in der Redaktion D dieser Textstufe, zumindest in WLB Stuttgart HB V 86, Bl. 153ra aus dem 15. Jahrhundert, siehe das Digitalisat
https://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz350733023/page/307 )
Doch genug von Trutwin. Die Belege zu ihm können bei mir oder ausführlicher bei Walther Ludwig (Esslinger Studien 34, 1995, S. 1-19, ohne Kenntnis meines VL-Artikels, der im gleichen Jahr erschien) nachgelesen werden.
Für den überregionalen Ruf der Esslinger Ärzte verwies ich im Verfasserlexikon auf die in Konstanz ausgestellte Salemer Urkunde von 1291 März 28, in der von den Behandlungskosten für die Ehefrau des Konrad von Ramschwag in Esslingen die Rede ist:
Chartularium Sangallense IV, 1985, Nr. 2269
https://monasterium.net/mom/CSGIV/1291_III_28/charter
Zuvor schon bei Weech, Codex diplomaticus Salemitanus abgedruckt:
https://archive.org/stream/CodexDiplomaticusSalemitanusVol.2/Codex_diplomaticus_Salemitanus_Urkundenb#page/n453/mode/2up
Auf diese Urkunde bezog sich schon Mone mit seinem Hinweis auf ZGO 10, S. 412:
https://books.google.de/books?id=ZzUPAAAAYAAJ&pg=PA412
Im gleichen Salemer Bestand findet sich auch die Urkunde des Klosters Kaisheims über die Besetzung einer Pfründe an der Kapellenstiftung Magister Trutwins "phisicus in Ezzelinga". Im Fall der Säumnis soll Salem zuständig sein (1298 April 16 Esslingen).
https://archive.org/stream/CodexDiplomaticusSalemitanusVol.2/Codex_diplomaticus_Salemitanus_Urkundenb#page/n595/mode/2up
Mehrfach wird ungefähr zur gleichen Zeit ein offenbar angesehener Esslinger Arzt Rudolf erwähnt (auf ihn wies schon Mone hin). 1272 übertrug er dem Kloster Sirnau Weinberge und siegelte die Urkunde mit einem berufsspezifischen Siegelbild, das nach der späteren Urkunde von 1279 Mai 14 beschrieben wird:
spitzoval, 39, 23 mm, (II. B.): eine auf einem Stuhle sitzende Person, ein Glas emporhaltend, d. h. ein Arzt mit einem Arzneiglas: Umschrift: + S . MAG(ist)RI . RV̊DOLFI . PHISICI.
https://www.wubonline.de/?wub=3039
Das Harnglas war das übliche Attribut der Ärzte und wurde auch von Magister Trutwin in seinem Siegel verwendet. Abbildung des Siegels an der Urkunde 1304 Dezember 18 bei Eberhard Niktisch, Dionysius Dreytwein, Esslinger Studien 24, 1985, S. 176 mit Kommentar.
1279 Mai 14: "Meister Rudolf der Arzt in Esslingen, Pleban in Ehningen, vermacht unter Vorbehalt gewisser Nutznießungen für seine Konkubine Guta dem Kloster Bebenhausen sein Haus vor dem Schöllkopfstor in Esslingen und 11 Morgen Weinberg".
https://www.wubonline.de/?wub=3733
Abdruck (und weitere Siegelbeschreibung) in der ZGO 3, S. 339-341
https://books.google.de/books?id=q6oOAAAAYAAJ&pg=PA339
Der Arzt war also zugleich Seelsorgekleriker, der es mit dem Zölibat nicht genau nahm. Aber er scheint seinen geistlichen Stand aufgegeben zu haben, denn 1287 Februar 16 erfahren wir:
"Meister Rudolf der Arzt, seine Frau Guta und deren Mutter von Esslingen schenken dem Kloster Bebenhausen ihre Häuser mit Gütern in Esslingen und Weinberge in Beutelsbach, Heppach1 und Strümpfelbach samt dem Hof Winzen bei Beutelsbach unter Vorbehalt lebenslänglicher Nutznießung."
https://www.wubonline.de/?wub=4513 (nur Regest)
Ebenfalls nur Regest, aber ausführlicher: Eßlinger Urkundenbuch 1, S. 43
https://archive.org/stream/urkundenbuchder00pfafgoog#page/n103/mode/2up
Nach dem Tod der Guta, die nun "uxor eius legitima" des Magister Rudolf heißt, erhielt der Pfarrer von Oberesslingen den Hof Winzen als Leibgeding. Es siegelte wieder Rudolf mit dem genannten Harnglas (Esslingen, 1296. April 8).
https://www.wubonline.de/?wub=5824
Zu nennen ist noch eine Erwähnung 1279 Oktober 21, als Meister Rudolf der Arzt im Predigerkloster Esslingen einen Güterverkauf bezeugte.
https://archive.org/stream/urkundenbuchder00pfafgoog#page/n105/mode/2up
1280 November 22 erscheint in Esslingen als Zeuge ein Arzt Rupert ("magistro Růperto medico").
https://www.wubonline.de/?wub=3859
zuvor schon bei Weech 2, S. 246 (online wie oben)
Möglicherweise ein anderer Esslinger Arzt Rupert hatte eine Pfründe in Ehrenstein bei Ulm innegehabt haben, wie aus einem Verhör Söflinger Zeugen um 1301 hervorgeht.
Al. capellanus predicti monasterii in Sevelingen testis iuratus non odio etc. rogatus super primo articulo, in quo dicitur, quod predictus Johannes sit legitime presentatus a predictis abbatissa et conventu ad prefatam capellam in Erigstain, rogatus dicit, quod cum ipsa capella vacavit, nescit tamen utrum per mortem vel per resignationem quondam magistri R[uperti] phisici de Esselingen
https://www.wubonline.de/?wub=35
Zur Datierung sieht man besser in das Digitalisat des WUB-Drucks
https://archive.org/stream/wirtembergisches08wruoft#page/298/mode/2up
Er wird vom Register des gedruckten WUB gleichgesetzt mit einem Magister Rupert von Esslingen, der 1278 Mai 3 in Marchtal zeugt.
https://www.wubonline.de/?wub=3626
Die vorgestellten Belege lassen den Schluss zu, dass Esslingen am Ende des 13. Jahrhunderts ein Zentrum medizinischen Wissens in Schwaben war. Sogar eine Adelige aus dem Bodenseeraum kam nach Esslingen, um sich behandeln zu lassen. Nachweisbar sind in der Zeit Rudolfs von Habsburg neben Trutwin, dessen Handschriften die älteste erhaltene Bibliothek eines deutschen Arztes darstellen, ein offenbar recht wohlhabender Magister Rudolf mit eigenem Siegel und zwei (?) Ärzte des Namens Rupert. Rudolf und mindestens einer der Ruperte waren Kleriker; Rudolf war verheiratet.
Gut würde es passen, wenn in Esslingen damals auch ein Apotheker ansässig gewesen wäre. Ein "Sitz altdeutscher Kunst und Bildung war Esslingen, denn wir finden in seiner Geschichte schon im Jahr 1300 einen Apotheker Heinrich", heißt es in einem Aufsatz von 1849.
https://books.google.de/books?id=aQtAAAAAcAAJ&pg=PA141
Leider gibt Karl Pfaff, auf den diese Nachricht zurückgeht, keine Quelle an.
https://books.google.de/books?id=tqRYAAAAcAAJ&pg=PA241
Im Esslinger Urkundenbuch findet man dazu nichts, und die Esslinger Lokalforschung hat schon lange festgestellt, dass Pfaff das Steuerbuch von 1400 fälschlich zurückdatiert hat. Siehe etwa die Dissertation von Manfred Schlözer 2002, S. 37
https://hsbiblio.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/48348/pdf/Diss_Druckvers1.PDF?sequence=1&isAllowed=y
Siehe schon Wankmüller in seinen Beiträgen Jg. 5, S. 103
https://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00033312
Den Esslinger Apotheker von 1300, der noch in moderner Fachliteratur herumgeistert (auch in der Variante „Hans der apategger“), bitte streichen!
***
Zu Reutlinger Ärzten (14.-17. Jahrhundert):
https://archiv.twoday.net/stories/1022375809/
#forschung
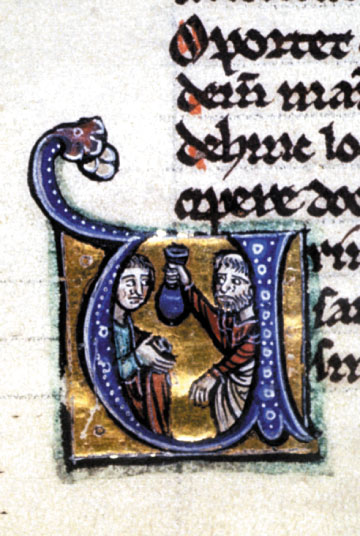
https://books.google.de/books?id=-6wOAAAAYAAJ&hl=de&pg=PA17
Mit dem dort genannten Magister Trutwin (bezeugt in Esslingen als Arzt 1279 bis 1314) habe ich mich in einem Verfasserlexikon-Artikel 1995 näher befasst. Man findet den Artikel mit der Suche nach Trutwin in:
https://www.amazon.de/deutsche-Literatur-Mittelalters-Verfasserlexikon-Reinbold/dp/3110140241/ (für registrierte Benutzer)
Trutwin darf als Verfasser eines lateinischen Gedichts über den Sieg im Reichskrieg gegen Graf Eberhard 1311/12 gelten. Man hat auch die einzigartige Darstellung der Philosophen Plato und Aristoteles im Credofenster der Esslinger Pfarrkirche auf Trutwin zurückführen wollen. Abbildungen:
https://home.bawue.de/~wmwerner/essling/glas04.html
Es gelang mir 1995, den lange vergessenen Zusammenhang zwischen den Esslinger Belegen und den Handschriften eines Magister Trutwin in Stams und Innsbruck wiederherzustellen. Ich konnte seine annalistischen Notizen mit der Fortsetzung der Flores temporum zusammenbringen. Später machte mich Felix Heinzer auf eine Donaueschinger (nun Stuttgarter) Handschrift Trutwins aufmerksam:
https://www.handschriftencensus.de/10574
https://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2000/0215.html
Die Art und Weise, wie Nigel Palmer meine genuine Forschungsleistung 2005 nicht anerkannt hat [auf Wunsch von Herrn Palmer entfernt].
https://books.google.de/books?id=-V4jhcJqY-UC&pg=PA263
Die annalistischen Notizen Trutwins überliefert Innsbruck Cod. 141, Bl. 1v. Der Handschriftenbeschreiber Walter Neuhauser berief sich dort auf meine Mitteilungen aus Niederfell 1988 (damals war ich ans Bundesarchiv Koblenz abgeordnet als Referendar):
https://manuscripta.at/_scripts/php/cat2pdf.php?cat=INN2&ID=7722
Bislang nicht beachtet wurde, dass die Notiz über die Esslinger Wundergeburt 1281 (die den Arzt Trutwin besonders interessieren musste) noch im 13. Jahrhundert mit dem Vermerk "Magister Trutwinus personaliter vidit" in die von Georg Leidinger 1910 edierten Kaisheimer Annalen einging.
https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00084193/image_33
Zur Quelle:
https://www.geschichtsquellen.de/repOpus_00221.html
Schon Leidinger bemerkte, dass damit nicht der aus Esslingen stammende Kaisheimer Abt Trutwin gemeint war, sondern der Esslinger Arzt des Namens, offenbar ein Verwandter des Kaisheimer Abts.
Die Stelle zur Geburt des Monstrums in der Pliensau 1281 in Meuschens Ausgabe der Flores temporum:
https://books.google.de/books?id=ucAWAAAAQAAJ&pg=PA130
(Zu den online verfügbaren Handschriften des Werks, relevant ist hier die Textstufe 3:
https://archiv.twoday.net/stories/248918667/
Der Bericht erscheint auch in der Redaktion D dieser Textstufe, zumindest in WLB Stuttgart HB V 86, Bl. 153ra aus dem 15. Jahrhundert, siehe das Digitalisat
https://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz350733023/page/307 )
Doch genug von Trutwin. Die Belege zu ihm können bei mir oder ausführlicher bei Walther Ludwig (Esslinger Studien 34, 1995, S. 1-19, ohne Kenntnis meines VL-Artikels, der im gleichen Jahr erschien) nachgelesen werden.
Für den überregionalen Ruf der Esslinger Ärzte verwies ich im Verfasserlexikon auf die in Konstanz ausgestellte Salemer Urkunde von 1291 März 28, in der von den Behandlungskosten für die Ehefrau des Konrad von Ramschwag in Esslingen die Rede ist:
Chartularium Sangallense IV, 1985, Nr. 2269
https://monasterium.net/mom/CSGIV/1291_III_28/charter
Zuvor schon bei Weech, Codex diplomaticus Salemitanus abgedruckt:
https://archive.org/stream/CodexDiplomaticusSalemitanusVol.2/Codex_diplomaticus_Salemitanus_Urkundenb#page/n453/mode/2up
Auf diese Urkunde bezog sich schon Mone mit seinem Hinweis auf ZGO 10, S. 412:
https://books.google.de/books?id=ZzUPAAAAYAAJ&pg=PA412
Im gleichen Salemer Bestand findet sich auch die Urkunde des Klosters Kaisheims über die Besetzung einer Pfründe an der Kapellenstiftung Magister Trutwins "phisicus in Ezzelinga". Im Fall der Säumnis soll Salem zuständig sein (1298 April 16 Esslingen).
https://archive.org/stream/CodexDiplomaticusSalemitanusVol.2/Codex_diplomaticus_Salemitanus_Urkundenb#page/n595/mode/2up
Mehrfach wird ungefähr zur gleichen Zeit ein offenbar angesehener Esslinger Arzt Rudolf erwähnt (auf ihn wies schon Mone hin). 1272 übertrug er dem Kloster Sirnau Weinberge und siegelte die Urkunde mit einem berufsspezifischen Siegelbild, das nach der späteren Urkunde von 1279 Mai 14 beschrieben wird:
spitzoval, 39, 23 mm, (II. B.): eine auf einem Stuhle sitzende Person, ein Glas emporhaltend, d. h. ein Arzt mit einem Arzneiglas: Umschrift: + S . MAG(ist)RI . RV̊DOLFI . PHISICI.
https://www.wubonline.de/?wub=3039
Das Harnglas war das übliche Attribut der Ärzte und wurde auch von Magister Trutwin in seinem Siegel verwendet. Abbildung des Siegels an der Urkunde 1304 Dezember 18 bei Eberhard Niktisch, Dionysius Dreytwein, Esslinger Studien 24, 1985, S. 176 mit Kommentar.
1279 Mai 14: "Meister Rudolf der Arzt in Esslingen, Pleban in Ehningen, vermacht unter Vorbehalt gewisser Nutznießungen für seine Konkubine Guta dem Kloster Bebenhausen sein Haus vor dem Schöllkopfstor in Esslingen und 11 Morgen Weinberg".
https://www.wubonline.de/?wub=3733
Abdruck (und weitere Siegelbeschreibung) in der ZGO 3, S. 339-341
https://books.google.de/books?id=q6oOAAAAYAAJ&pg=PA339
Der Arzt war also zugleich Seelsorgekleriker, der es mit dem Zölibat nicht genau nahm. Aber er scheint seinen geistlichen Stand aufgegeben zu haben, denn 1287 Februar 16 erfahren wir:
"Meister Rudolf der Arzt, seine Frau Guta und deren Mutter von Esslingen schenken dem Kloster Bebenhausen ihre Häuser mit Gütern in Esslingen und Weinberge in Beutelsbach, Heppach1 und Strümpfelbach samt dem Hof Winzen bei Beutelsbach unter Vorbehalt lebenslänglicher Nutznießung."
https://www.wubonline.de/?wub=4513 (nur Regest)
Ebenfalls nur Regest, aber ausführlicher: Eßlinger Urkundenbuch 1, S. 43
https://archive.org/stream/urkundenbuchder00pfafgoog#page/n103/mode/2up
Nach dem Tod der Guta, die nun "uxor eius legitima" des Magister Rudolf heißt, erhielt der Pfarrer von Oberesslingen den Hof Winzen als Leibgeding. Es siegelte wieder Rudolf mit dem genannten Harnglas (Esslingen, 1296. April 8).
https://www.wubonline.de/?wub=5824
Zu nennen ist noch eine Erwähnung 1279 Oktober 21, als Meister Rudolf der Arzt im Predigerkloster Esslingen einen Güterverkauf bezeugte.
https://archive.org/stream/urkundenbuchder00pfafgoog#page/n105/mode/2up
1280 November 22 erscheint in Esslingen als Zeuge ein Arzt Rupert ("magistro Růperto medico").
https://www.wubonline.de/?wub=3859
zuvor schon bei Weech 2, S. 246 (online wie oben)
Möglicherweise ein anderer Esslinger Arzt Rupert hatte eine Pfründe in Ehrenstein bei Ulm innegehabt haben, wie aus einem Verhör Söflinger Zeugen um 1301 hervorgeht.
Al. capellanus predicti monasterii in Sevelingen testis iuratus non odio etc. rogatus super primo articulo, in quo dicitur, quod predictus Johannes sit legitime presentatus a predictis abbatissa et conventu ad prefatam capellam in Erigstain, rogatus dicit, quod cum ipsa capella vacavit, nescit tamen utrum per mortem vel per resignationem quondam magistri R[uperti] phisici de Esselingen
https://www.wubonline.de/?wub=35
Zur Datierung sieht man besser in das Digitalisat des WUB-Drucks
https://archive.org/stream/wirtembergisches08wruoft#page/298/mode/2up
Er wird vom Register des gedruckten WUB gleichgesetzt mit einem Magister Rupert von Esslingen, der 1278 Mai 3 in Marchtal zeugt.
https://www.wubonline.de/?wub=3626
Die vorgestellten Belege lassen den Schluss zu, dass Esslingen am Ende des 13. Jahrhunderts ein Zentrum medizinischen Wissens in Schwaben war. Sogar eine Adelige aus dem Bodenseeraum kam nach Esslingen, um sich behandeln zu lassen. Nachweisbar sind in der Zeit Rudolfs von Habsburg neben Trutwin, dessen Handschriften die älteste erhaltene Bibliothek eines deutschen Arztes darstellen, ein offenbar recht wohlhabender Magister Rudolf mit eigenem Siegel und zwei (?) Ärzte des Namens Rupert. Rudolf und mindestens einer der Ruperte waren Kleriker; Rudolf war verheiratet.
Gut würde es passen, wenn in Esslingen damals auch ein Apotheker ansässig gewesen wäre. Ein "Sitz altdeutscher Kunst und Bildung war Esslingen, denn wir finden in seiner Geschichte schon im Jahr 1300 einen Apotheker Heinrich", heißt es in einem Aufsatz von 1849.
https://books.google.de/books?id=aQtAAAAAcAAJ&pg=PA141
Leider gibt Karl Pfaff, auf den diese Nachricht zurückgeht, keine Quelle an.
https://books.google.de/books?id=tqRYAAAAcAAJ&pg=PA241
Im Esslinger Urkundenbuch findet man dazu nichts, und die Esslinger Lokalforschung hat schon lange festgestellt, dass Pfaff das Steuerbuch von 1400 fälschlich zurückdatiert hat. Siehe etwa die Dissertation von Manfred Schlözer 2002, S. 37
https://hsbiblio.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/48348/pdf/Diss_Druckvers1.PDF?sequence=1&isAllowed=y
Siehe schon Wankmüller in seinen Beiträgen Jg. 5, S. 103
https://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00033312
Den Esslinger Apotheker von 1300, der noch in moderner Fachliteratur herumgeistert (auch in der Variante „Hans der apategger“), bitte streichen!
***
Zu Reutlinger Ärzten (14.-17. Jahrhundert):
https://archiv.twoday.net/stories/1022375809/
#forschung
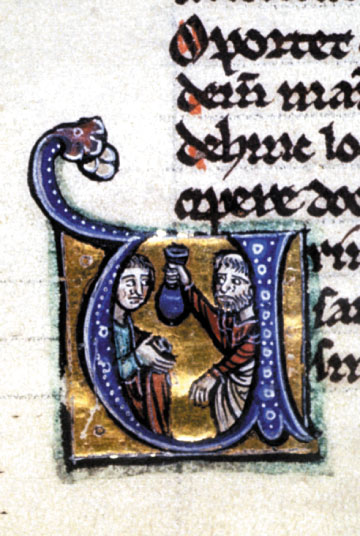
KlausGraf - am Sonntag, 12. April 2015, 00:26 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Vgl. Schulte, ZGO 1893
https://archive.org/stream/zeitschriftfrdi01langoog#page/n527/mode/2up
nach der Abbildung bei Schilter bei S. 1107
https://epub.ub.uni-muenchen.de/11726/
https://www.rdklabor.de/wiki/Fahne_%28milit%C3%A4risch%29#B._Karrasche

https://archive.org/stream/zeitschriftfrdi01langoog#page/n527/mode/2up
nach der Abbildung bei Schilter bei S. 1107
https://epub.ub.uni-muenchen.de/11726/
https://www.rdklabor.de/wiki/Fahne_%28milit%C3%A4risch%29#B._Karrasche

KlausGraf - am Sonntag, 12. April 2015, 00:04 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

