Kodikologie
Neulich unterließ ich bei Meldung des Digitalisats des Tübinger Mh 369
https://archiv.twoday.net/stories/142782578/
einen Hinweis auf die ganz kurzen Auszüge zu einer deutschsprachigen Handschrift, die Magister Johannes Wieland, Kaplan zu Stuttgart, 1492 dem Kirchheimer Dominikanerinnenkloster schenkte. Rolf Götz schrieb mir, dass weder in der Chronik der Magdalena Kremer noch in der Dissertation von Ulrich Ecker zu den Urkunden des Klosters die Person erwähnt wird. Als ich jetzt in Löfflers Buch zu den Zwiefalter Handschriften blätterte, erinnerte ich mich an den Namen. Oliver Auge hat in seiner Prosopographie der Kleriker des Stuttgarter Stifts Belege zu Wieland zusammengetragen (Stiftsbiographien, 2002, S. 499f. Nr. 288), die ich aber jetzt vermehren kann.
Im Wintersemester 1457 wurde er in Wien immatrikuliert mit der Herkunftsbezeichnung Stuttgart (Matrikel Bd. 2, 1457 II R 75, zitiert nach Auge). Er dürfte um 1440/45 geboren worden sein.
Es liegt nahe, einen verwandtschaftlichen Zusammenhang mit dem in Wien wirkenden Astronomen Johann Wielant von Stuttgart (1438/39 bis 1452 in Wien belegt) zu vermuten, siehe Uiblein 1999, S,. 412
https://books.google.de/books?id=qc4d4P42eFoC
Der jüngere Johann Wieland bezog 1463 die Freiburger Universität als Wiener Bakkalar (Matrikel Bd. 1, S. 22.39, zitiert nach Auge)
Der Meister Johann Wieland, der gemeinsam mit dem Sindelfinger Propst Johann Tegen vermutlich 1469 mit dem Statthalter des Grafen von Horn in den Niederlanden wegen der Mitgift der Tochter Philippe Ulrichs V. von Württemberg verhandelte, ist wohl unser Johann Wieland. Die Instruktion ist online einsehbar:
https://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-25211 (nicht bei Auge)
1477 ist er als Kaplan des Stuttgarter Heilig-Kreuz-Stifts Zeuge. Es ist die einzige Erwähnung im Stuttgarter Urkundenbuch:
https://archive.org/stream/UrkundenbuchDerStadtStuttgart#page/n351/mode/2up
Zu 1490 weist ihn Auge als Mitglied zweier Stuttgarter Bruderschaften nach, der Salve Regina Bruderschaft und der Priesterbruderschaft. Ein Beleg nennt einen Stiftsvikar Johann Wieland ohne den Magistertitel, doch ist wohl nicht an einen anderen Kleriker des gleichen Namens zu denken.
Das Crusius-Exzerpt zu 1492 ist sicher Auszug aus einem umfangreicheren Text:
https://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/Mh369/0030
Handschriftenbeschreibung:
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0542_a269_jpg.htm
Es steht ziemlich vollständig auch in den Annales Suevici (wonach es Auge kannte):
https://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/LI25_fol-2/0146 = Crusius (übersetzt von Moser Bd. 2, S. 140)
Undatiert ist eine Bücherschenkung an das Stuttgarter Dominikanerkloster, von der nur ein alter Zwiefalter Katalog Zeugnis ablegt. "Rev. Magister Joh. Wielant" schenkte Sermones varii aus dem 15. Jahrhundert. Die Handschrift kam später nach Zwiefalten und ist verschollen
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1067432
Neidiger, Das Dominikanerkloster Stuttgart ... 1993, S. 32 Anm. 162 erwähnte diese Schenkung, was Auge übersah.
Ebenso blieb Auge unbekannt, dass Johannes Reuchlin 1495 auf Bitten des Stuttgarter Kaplans Johann Wieland für die Stuttgarter Stiftsherren einen Kommentar zur Mariensequenz "Ave virginalis forma" verfasste, überliefert als Autograph in ÖNB Wien Cod. 3116. Siehe den Artikel zu Johannes Reuchlin im Humanismus-Verfasserlexikon:
https://books.google.com/books?id=EKQx4ixSqwcC&pg=PT147
Der Name erscheint im alten Tabulae-Katalog zum Wiener Codex.
https://books.google.de/books?id=yS5AAQAAIAAJ&pg=PA200
nicht aber in Stefan Rheins Reuchliniana II (Johannes Reuchlin, 1994, S. 297). Die angekündigte Edition im FDA ist noch nicht zustandegekommen. Der Name erscheint aber in Rheins italienischer Publikation von 1990:
https://goo.gl/8hR2P
Zur Wiener Handschrift:
https://manuscripta.at/?ID=6666
Kurz erwähnt im Freiburger Überlieferungskatalog der Bebel-Werke
https://web.archive.org/web/20031026113100/https://www.sfb541.uni-freiburg.de/B5/Bebel/Werke_Heinrich_Bebels.pdf
Damit stellen diese Notizen zu Magister Johann Wieland aus Stuttgart auch einen kleinen Beitrag zur Reuchlin-Forschung dar.
Nachtrag: Zum Kloster Kirchheim siehe auch
https://archiv.twoday.net/stories/404097950/
#forschung
https://archiv.twoday.net/stories/142782578/
einen Hinweis auf die ganz kurzen Auszüge zu einer deutschsprachigen Handschrift, die Magister Johannes Wieland, Kaplan zu Stuttgart, 1492 dem Kirchheimer Dominikanerinnenkloster schenkte. Rolf Götz schrieb mir, dass weder in der Chronik der Magdalena Kremer noch in der Dissertation von Ulrich Ecker zu den Urkunden des Klosters die Person erwähnt wird. Als ich jetzt in Löfflers Buch zu den Zwiefalter Handschriften blätterte, erinnerte ich mich an den Namen. Oliver Auge hat in seiner Prosopographie der Kleriker des Stuttgarter Stifts Belege zu Wieland zusammengetragen (Stiftsbiographien, 2002, S. 499f. Nr. 288), die ich aber jetzt vermehren kann.
Im Wintersemester 1457 wurde er in Wien immatrikuliert mit der Herkunftsbezeichnung Stuttgart (Matrikel Bd. 2, 1457 II R 75, zitiert nach Auge). Er dürfte um 1440/45 geboren worden sein.
Es liegt nahe, einen verwandtschaftlichen Zusammenhang mit dem in Wien wirkenden Astronomen Johann Wielant von Stuttgart (1438/39 bis 1452 in Wien belegt) zu vermuten, siehe Uiblein 1999, S,. 412
https://books.google.de/books?id=qc4d4P42eFoC
Der jüngere Johann Wieland bezog 1463 die Freiburger Universität als Wiener Bakkalar (Matrikel Bd. 1, S. 22.39, zitiert nach Auge)
Der Meister Johann Wieland, der gemeinsam mit dem Sindelfinger Propst Johann Tegen vermutlich 1469 mit dem Statthalter des Grafen von Horn in den Niederlanden wegen der Mitgift der Tochter Philippe Ulrichs V. von Württemberg verhandelte, ist wohl unser Johann Wieland. Die Instruktion ist online einsehbar:
https://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-25211 (nicht bei Auge)
1477 ist er als Kaplan des Stuttgarter Heilig-Kreuz-Stifts Zeuge. Es ist die einzige Erwähnung im Stuttgarter Urkundenbuch:
https://archive.org/stream/UrkundenbuchDerStadtStuttgart#page/n351/mode/2up
Zu 1490 weist ihn Auge als Mitglied zweier Stuttgarter Bruderschaften nach, der Salve Regina Bruderschaft und der Priesterbruderschaft. Ein Beleg nennt einen Stiftsvikar Johann Wieland ohne den Magistertitel, doch ist wohl nicht an einen anderen Kleriker des gleichen Namens zu denken.
Das Crusius-Exzerpt zu 1492 ist sicher Auszug aus einem umfangreicheren Text:
https://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/Mh369/0030
Handschriftenbeschreibung:
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0542_a269_jpg.htm
Es steht ziemlich vollständig auch in den Annales Suevici (wonach es Auge kannte):
https://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/LI25_fol-2/0146 = Crusius (übersetzt von Moser Bd. 2, S. 140)
Undatiert ist eine Bücherschenkung an das Stuttgarter Dominikanerkloster, von der nur ein alter Zwiefalter Katalog Zeugnis ablegt. "Rev. Magister Joh. Wielant" schenkte Sermones varii aus dem 15. Jahrhundert. Die Handschrift kam später nach Zwiefalten und ist verschollen
https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1067432
Neidiger, Das Dominikanerkloster Stuttgart ... 1993, S. 32 Anm. 162 erwähnte diese Schenkung, was Auge übersah.
Ebenso blieb Auge unbekannt, dass Johannes Reuchlin 1495 auf Bitten des Stuttgarter Kaplans Johann Wieland für die Stuttgarter Stiftsherren einen Kommentar zur Mariensequenz "Ave virginalis forma" verfasste, überliefert als Autograph in ÖNB Wien Cod. 3116. Siehe den Artikel zu Johannes Reuchlin im Humanismus-Verfasserlexikon:
https://books.google.com/books?id=EKQx4ixSqwcC&pg=PT147
Der Name erscheint im alten Tabulae-Katalog zum Wiener Codex.
https://books.google.de/books?id=yS5AAQAAIAAJ&pg=PA200
nicht aber in Stefan Rheins Reuchliniana II (Johannes Reuchlin, 1994, S. 297). Die angekündigte Edition im FDA ist noch nicht zustandegekommen. Der Name erscheint aber in Rheins italienischer Publikation von 1990:
https://goo.gl/8hR2P
Zur Wiener Handschrift:
https://manuscripta.at/?ID=6666
Kurz erwähnt im Freiburger Überlieferungskatalog der Bebel-Werke
https://web.archive.org/web/20031026113100/https://www.sfb541.uni-freiburg.de/B5/Bebel/Werke_Heinrich_Bebels.pdf
Damit stellen diese Notizen zu Magister Johann Wieland aus Stuttgart auch einen kleinen Beitrag zur Reuchlin-Forschung dar.
Nachtrag: Zum Kloster Kirchheim siehe auch
https://archiv.twoday.net/stories/404097950/
#forschung
KlausGraf - am Montag, 10. Dezember 2012, 17:41 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Boccaccio-Handschrift (Italien, um 1360) in der Schulbibliothek des Hamburger Christianeums, abgebildet im empfehlenswerten Kalender der Freunde der Bibliothek für 2013, erhältlich für 10 Euro. Alles weitere:
https://anonymea.tumblr.com/post/37267168751/erkundungen-in-der-bibliothek-des-christianeums
KlausGraf - am Sonntag, 9. Dezember 2012, 00:04 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
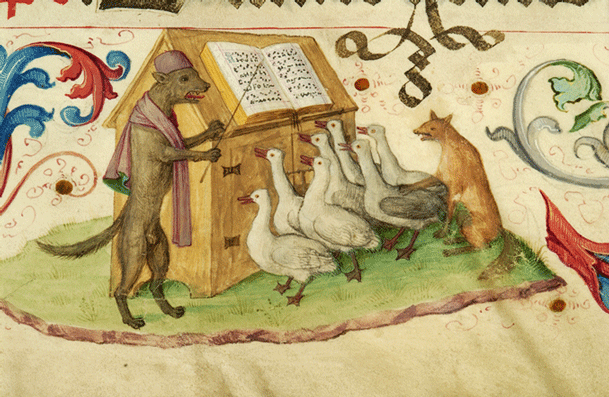
Die zweibändige liturgische Handschrift (englisch: "Geesebook"), die 1952 stiftungswidrig von der Nürnberger Pfarrei St. Lorenz zum Dank für Wiederaufbauhilfe an die Kress-Stiftung in die USA geschenkt wurde und heute von der Pierpont Morgan Library verwahrt wird (M. 905), kann jetzt in ihrer ganzen Pracht online durchblättert werden:
https://geesebook.asu.edu
Das Datum 1952 stammt aus
https://www.medievalists.net/2012/11/28/the-geese-book-medieval-manuscript-now-available-online/
bzw.
https://acmrs.org/news/press-release-opening-geese-book
Auf der Website habe ich es auf Anhieb nicht gefunden. Merkl, Buchmalerei 1999 Katalog Nr. 65 gibt S. 386 das Datum 1958. Es handelt sich nach Merkl um das von Jacob Elsner gemalte Graduale der Lorenzkirche 1507/10 (deutsch: "Gänsebuch")
KlausGraf - am Mittwoch, 5. Dezember 2012, 00:29 - Rubrik: Kodikologie
Ich wollte kaum glauben, was ich bei
https://www.inthemedievalmiddle.com/2012/11/medieval-manuscript-images-and-copyright.html
las. Aber es stimmt!
Access Reuse Guidance Notes for the Catalogue of Illuminated Manuscripts
The Catalogue of Illuminated Manuscripts content is now available for download and reuse. Although still technically in copyright in the UK (and a number of other common law territories) the images are being made available under a Public Domain Mark* which indicates that there are no copyright restrictions on reproduction, adaptation, republication or sharing of the content available from the site.
However the British Library asks that anyone reusing digital objects from this collection applies the following principles:
Please respect the creators – ensure traditional cultural expressions and all ethical concerns in the use of the material are considered, and any information relating to the creator is clear and accurate. Please note, any adaptations made to an item should not be attributed to the original creator and should not be derogatory to the originating cultures or communities.
Please credit the source of the material – providing a link back to the image on the British Library’s website will encourage others to explore and use the collections.
Please share knowledge where possible – please annotate, tag and share derivative works with others as well as the Library wherever possible.
Support the Public Domain – users of public domain works are asked to support the efforts of the Library to care for, preserve, digitise and make public domain works available. This support could include monetary contributions or work in kind, particularly when the work is being used for commercial or other for-profit purposes.
Please preserve all public domain marks and notices attached to the works – this will notify other users that the images are free from copyright restrictions and encourage greater use of the collection.
This usage guide is based on goodwill. It is not a legal contract. We ask that you respect it.
https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/reuse.asp
William Noel vom Walter-Art-Museum sagt:
Libraries containing special collections of medieval materials are normally very careful to write restrictive copyright on their materials. Part of this is historical; that is to say, when images of these manuscripts were published in books, it didn’t have to behave like digital data, and it didn’t have to be free for people to use in all sorts of ways and in different contexts. The images were just reproduced in other books. But those days are fast running out, and digital images need to be free, so that people can do what they need to do with them and what they want to do with them. That’s the great thing about digital data!
https://blog.ted.com/2012/05/29/the-wide-open-future-of-the-art-museum-qa-with-william-noel/
Zum Thema hier:
https://archiv.twoday.net/stories/5405864/
 Pirckheimer-Salbuch https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=1619&CollID=20&NStart=49
Pirckheimer-Salbuch https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=1619&CollID=20&NStart=49
https://www.inthemedievalmiddle.com/2012/11/medieval-manuscript-images-and-copyright.html
las. Aber es stimmt!
Access Reuse Guidance Notes for the Catalogue of Illuminated Manuscripts
The Catalogue of Illuminated Manuscripts content is now available for download and reuse. Although still technically in copyright in the UK (and a number of other common law territories) the images are being made available under a Public Domain Mark* which indicates that there are no copyright restrictions on reproduction, adaptation, republication or sharing of the content available from the site.
However the British Library asks that anyone reusing digital objects from this collection applies the following principles:
Please respect the creators – ensure traditional cultural expressions and all ethical concerns in the use of the material are considered, and any information relating to the creator is clear and accurate. Please note, any adaptations made to an item should not be attributed to the original creator and should not be derogatory to the originating cultures or communities.
Please credit the source of the material – providing a link back to the image on the British Library’s website will encourage others to explore and use the collections.
Please share knowledge where possible – please annotate, tag and share derivative works with others as well as the Library wherever possible.
Support the Public Domain – users of public domain works are asked to support the efforts of the Library to care for, preserve, digitise and make public domain works available. This support could include monetary contributions or work in kind, particularly when the work is being used for commercial or other for-profit purposes.
Please preserve all public domain marks and notices attached to the works – this will notify other users that the images are free from copyright restrictions and encourage greater use of the collection.
This usage guide is based on goodwill. It is not a legal contract. We ask that you respect it.
https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/reuse.asp
William Noel vom Walter-Art-Museum sagt:
Libraries containing special collections of medieval materials are normally very careful to write restrictive copyright on their materials. Part of this is historical; that is to say, when images of these manuscripts were published in books, it didn’t have to behave like digital data, and it didn’t have to be free for people to use in all sorts of ways and in different contexts. The images were just reproduced in other books. But those days are fast running out, and digital images need to be free, so that people can do what they need to do with them and what they want to do with them. That’s the great thing about digital data!
https://blog.ted.com/2012/05/29/the-wide-open-future-of-the-art-museum-qa-with-william-noel/
Zum Thema hier:
https://archiv.twoday.net/stories/5405864/
 Pirckheimer-Salbuch https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=1619&CollID=20&NStart=49
Pirckheimer-Salbuch https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=1619&CollID=20&NStart=49KlausGraf - am Freitag, 30. November 2012, 00:09 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"„Überarbeitung und Online-Publikation der Erschließungsergebnisse aus dem DFG-Projekt zur Neukatalogisierung der ehemals Donaueschinger Handschriften in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe“
Seit 1993 werden die Handschriften der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek Donaueschingen in den Landesbibliotheken Karlsruhe und Stuttgart aufbewahrt. Der Bestand in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe umfasst dabei hauptsächlich deutschsprachige mittelalterliche Handschriften sowie germanistisch relevante Stücke des 18./19. Jahrhunderts. Er zählt zu den bedeutendsten Sammlungen deutschsprachiger Literatur des Mittelalters.
Der Anteil von Handschriften, die mittelhochdeutsche Literatur überliefern, ist außergewöhnlich groß. Dazu zählen neben der bekannten ‚Nibelungenlied‘-Hs. C (Don. 63) etwa der ‚Wasserburger Codex‘, in dem Rudolfs von Ems ‚Willehalm von Orlens‘ mit religiöser Kleinepik und Heldenepik vereint ist (Don. 74; 2. Viertel 14. Jh.), die sog.‚Liedersaal‘-Hs. (Don. 104; um 1425), eine der umfangreichsten Sammlungen mittelhochdeutscher Kleinepik, sowie zahlreiche Handschriften nachklassischer Artusromane (Konrad von Stoffeln, ‚Gauriel von Muntabel‘; Der Pleier, ‚Meleranz‘) und spätmittelalterlicher Prosaromane (‚Melusine‘, Prosa-‚Lancelot‘, Werke Ulrich Fuetrers und Heinrich Steinhöwels). Auch geistliche Literatur ist im Bestand vertreten, etwa die aufwändig illustrierten Handschriften Don. 106 (‚Christus und die minnende Seele‘; um 1495) und Don. 120 (Hugo von Ripelin, ‚Compendium theologicae veritatis‘ / Meisterliedersammlung ‚Donaueschinger Liederhandschrift‘; um 1480/1490).
Der ehem. Donaueschinger Handschriftenfonds ist aber nicht nur für die Text- und Überlieferungsgeschichte mittelhochdeutscher Literatur von großem Interesse, sondern auch für die frühneuzeitliche Rezeptions- und Bibliotheksgeschichte im südwestdeutschen Bereich. Mit der Bibliothek der Fürsten von Fürstenberg, die auf Graf Wolfgang (1465-1509) zurückgeht, und den historisch gewachsenen Büchersammlungen der Grafen von Zimmern und von Helfenstein bietet der Donaueschinger Bestand ein vielseitiges Abbild der literarischen Interessen süddeutscher Adelsgeschlechter in der frühen Neuzeit.
Ein besonders prominenter Teil der Fürstenbergischen Bibliothek ist seit 1855 die Handschriftensammlung Josephs von Laßberg. Laßberg, mittelalterbegeisterter Adliger und schillernde Persönlichkeit im Netzwerk der sich formierenden Altgermanistik des frühen 19. Jahrhunderts, sammelte nicht nur Originalhandschriften, sondern besaß auch zahlreiche Abschriften mittelalterlicher Manuskripte, die sich heute ebenfalls in der BLB Karlsruhe befinden. Zusammen mit der umfangreichen Korrespondenz, die Laßberg mit wichtigen Vertretern der frühen Germanistik führte, beleuchten sie eine zentrale kultur- und forschungsgeschichtliche Phase der beginnenden Wiederentdeckung des Mittelalters.
In den Jahren 1998-2004 wurde ein Teil des Bestandes (110 Handschriften) im Rahmen eines DFG-Projektes von Christoph Mackert und Wolfgang Runschke an der BLB Karlsruhe neu katalogisiert. Die Erschließungsergebnisse aus diesem Projekt werden nun mit Eigenmitteln der BLB Karlsruhe am Handschriftenzentrum der UB Leipzig überarbeitet, aktualisiert und über die Handschriftendatenbank Manuscripta Mediaevalia online zugänglich gemacht."
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/?INFO_projectinfo/donaueschingen#|5
Seit 1993 werden die Handschriften der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek Donaueschingen in den Landesbibliotheken Karlsruhe und Stuttgart aufbewahrt. Der Bestand in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe umfasst dabei hauptsächlich deutschsprachige mittelalterliche Handschriften sowie germanistisch relevante Stücke des 18./19. Jahrhunderts. Er zählt zu den bedeutendsten Sammlungen deutschsprachiger Literatur des Mittelalters.
Der Anteil von Handschriften, die mittelhochdeutsche Literatur überliefern, ist außergewöhnlich groß. Dazu zählen neben der bekannten ‚Nibelungenlied‘-Hs. C (Don. 63) etwa der ‚Wasserburger Codex‘, in dem Rudolfs von Ems ‚Willehalm von Orlens‘ mit religiöser Kleinepik und Heldenepik vereint ist (Don. 74; 2. Viertel 14. Jh.), die sog.‚Liedersaal‘-Hs. (Don. 104; um 1425), eine der umfangreichsten Sammlungen mittelhochdeutscher Kleinepik, sowie zahlreiche Handschriften nachklassischer Artusromane (Konrad von Stoffeln, ‚Gauriel von Muntabel‘; Der Pleier, ‚Meleranz‘) und spätmittelalterlicher Prosaromane (‚Melusine‘, Prosa-‚Lancelot‘, Werke Ulrich Fuetrers und Heinrich Steinhöwels). Auch geistliche Literatur ist im Bestand vertreten, etwa die aufwändig illustrierten Handschriften Don. 106 (‚Christus und die minnende Seele‘; um 1495) und Don. 120 (Hugo von Ripelin, ‚Compendium theologicae veritatis‘ / Meisterliedersammlung ‚Donaueschinger Liederhandschrift‘; um 1480/1490).
Der ehem. Donaueschinger Handschriftenfonds ist aber nicht nur für die Text- und Überlieferungsgeschichte mittelhochdeutscher Literatur von großem Interesse, sondern auch für die frühneuzeitliche Rezeptions- und Bibliotheksgeschichte im südwestdeutschen Bereich. Mit der Bibliothek der Fürsten von Fürstenberg, die auf Graf Wolfgang (1465-1509) zurückgeht, und den historisch gewachsenen Büchersammlungen der Grafen von Zimmern und von Helfenstein bietet der Donaueschinger Bestand ein vielseitiges Abbild der literarischen Interessen süddeutscher Adelsgeschlechter in der frühen Neuzeit.
Ein besonders prominenter Teil der Fürstenbergischen Bibliothek ist seit 1855 die Handschriftensammlung Josephs von Laßberg. Laßberg, mittelalterbegeisterter Adliger und schillernde Persönlichkeit im Netzwerk der sich formierenden Altgermanistik des frühen 19. Jahrhunderts, sammelte nicht nur Originalhandschriften, sondern besaß auch zahlreiche Abschriften mittelalterlicher Manuskripte, die sich heute ebenfalls in der BLB Karlsruhe befinden. Zusammen mit der umfangreichen Korrespondenz, die Laßberg mit wichtigen Vertretern der frühen Germanistik führte, beleuchten sie eine zentrale kultur- und forschungsgeschichtliche Phase der beginnenden Wiederentdeckung des Mittelalters.
In den Jahren 1998-2004 wurde ein Teil des Bestandes (110 Handschriften) im Rahmen eines DFG-Projektes von Christoph Mackert und Wolfgang Runschke an der BLB Karlsruhe neu katalogisiert. Die Erschließungsergebnisse aus diesem Projekt werden nun mit Eigenmitteln der BLB Karlsruhe am Handschriftenzentrum der UB Leipzig überarbeitet, aktualisiert und über die Handschriftendatenbank Manuscripta Mediaevalia online zugänglich gemacht."
https://www.manuscripta-mediaevalia.de/?INFO_projectinfo/donaueschingen#|5
KlausGraf - am Donnerstag, 29. November 2012, 18:19 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
25 Handschriften:
https://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/seligenthal
Was soll diese schändliche Heimlichtuerei bei der Klosterchronik? Was steht in einem Band aus dem 18. Jahrhundert, was man nur in Seligenthal sehen darf? Was haben die Nonnen zu verbergen?

https://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/seligenthal
Was soll diese schändliche Heimlichtuerei bei der Klosterchronik? Was steht in einem Band aus dem 18. Jahrhundert, was man nur in Seligenthal sehen darf? Was haben die Nonnen zu verbergen?

KlausGraf - am Donnerstag, 29. November 2012, 18:09 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 29. November 2012, 18:07 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
(von https://www.i-d-e.de/cfp-cpda3)
Als Fortsetzung der beiden bereits erschienenen Bände der Serie „Kodikologie und Paläographie im Digitalen Zeitalter (KPDZ I, 2009; KPDZ II, 2011) möchte das Institut für Dokumentologie und Editorik weiterhin verschiedene Ansätze im Bereich der Kodikologie und Paläographie dokumentieren und vergleichen. Aus diesem Grund plant das IDE einen dritten Band der Reihe „Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter“ zu publizieren. Wir bitten um Beiträge zu folgenden Themen:
Beiträge, die diese oder ähnliche Themen (vgl. vorherigen Call) behandeln, können in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch oder Spanisch eingereicht werden. Wir planen, auch diese Publikation als open access zu veröffentlichen. Wir bitten um Abstracts von nicht mehr als 500 Worten bis zum 22.12.2012 an die E-Mailadresse kpdz-iii@i-d-e.de.
Oliver Duntze (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz)
Oliver Hahn (Bundesanstalt für Materialforschung)
Torsten Schaßan (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel)
Als Fortsetzung der beiden bereits erschienenen Bände der Serie „Kodikologie und Paläographie im Digitalen Zeitalter (KPDZ I, 2009; KPDZ II, 2011) möchte das Institut für Dokumentologie und Editorik weiterhin verschiedene Ansätze im Bereich der Kodikologie und Paläographie dokumentieren und vergleichen. Aus diesem Grund plant das IDE einen dritten Band der Reihe „Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter“ zu publizieren. Wir bitten um Beiträge zu folgenden Themen:
- Moderne Verfahren der Bilderfassung (Multispektrafotografie, Thermografie)
- Bildverarbeitung (Segmentation, Mustererkennung, Layoutanalyse)
- Analyse von Schreibmaterialien (Tinten, Beschreibstoffe etc.)
- Beschreibung und Klassifikation von Handschriften, Schreiberhänden oder Drucktypen
- Semantische Beschreibung von Handschriften (Normdaten, RDF, Ontologien etc.)
- Archivierung, Sammlung, Verknüpfung von Informationen und Katalogdaten (z.B. Metakataloge und Portale)
- Kollaborative Erschließung, Beschreibung, Transkription oder Edition
- Quantitative Kodikologie und Bibliographie
- Neue Verfahren der Präsentation von Forschungsdaten (Visualisierung, Apps, Text-Bild-Synopsen, Annotationsmögichkeiten etc.)
Beiträge, die diese oder ähnliche Themen (vgl. vorherigen Call) behandeln, können in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch oder Spanisch eingereicht werden. Wir planen, auch diese Publikation als open access zu veröffentlichen. Wir bitten um Abstracts von nicht mehr als 500 Worten bis zum 22.12.2012 an die E-Mailadresse kpdz-iii@i-d-e.de.
Oliver Duntze (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz)
Oliver Hahn (Bundesanstalt für Materialforschung)
Torsten Schaßan (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel)
gvogeler - am Montag, 26. November 2012, 15:53 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00077958/image_41
Unverständlicherweise nur Schwarzweiß online!
Zu Dietrich-Bild-Testimonien:
https://archiv.twoday.net/stories/156273365/
Es handelt sich um eine Abschrift der dort besprochenen Kölderer-Rolle (erwähnt im Katalog Hispania Austria 1992 Nr. 177).
Ebenfalls neu online sind Bildreihen bayerischen Regenten: Cgm 1603 und Cgm 2824. Sowie die Lirer-Abschrift im Cgm 699.
Unverständlicherweise nur Schwarzweiß online!
Zu Dietrich-Bild-Testimonien:
https://archiv.twoday.net/stories/156273365/
Es handelt sich um eine Abschrift der dort besprochenen Kölderer-Rolle (erwähnt im Katalog Hispania Austria 1992 Nr. 177).
Ebenfalls neu online sind Bildreihen bayerischen Regenten: Cgm 1603 und Cgm 2824. Sowie die Lirer-Abschrift im Cgm 699.
KlausGraf - am Freitag, 23. November 2012, 23:20 - Rubrik: Kodikologie
Von 1530/40 in der Digitalen Bibliothek des GNM:
https://dlib.gnm.de/item/Hs22474
Update:
https://zeitspuren.eu/2012/11/17/unter-der-kutte/

https://dlib.gnm.de/item/Hs22474
Update:
https://zeitspuren.eu/2012/11/17/unter-der-kutte/
KlausGraf - am Freitag, 16. November 2012, 21:15 - Rubrik: Kodikologie